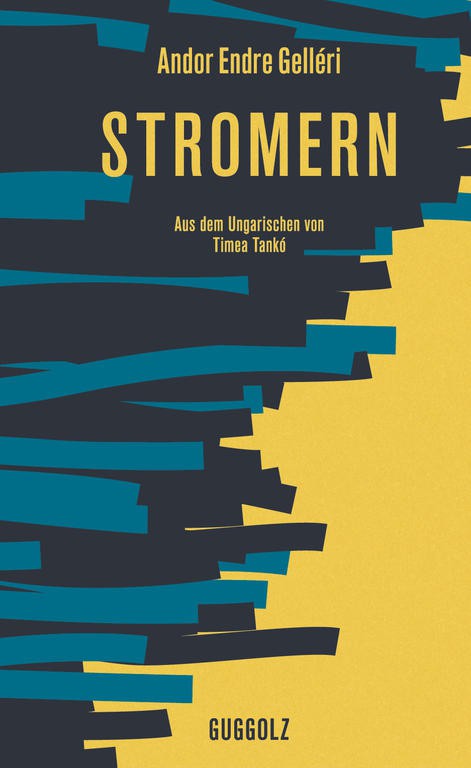Am Himmel ist eine Sonne geboren, und niemand hat es gesehen
Die schönste Seite der Krise ist der Wendepunkt, von dem an nichts mehr ist und nichts mehr sein kann, wie es war. Und während uns die Sicherungen abhanden kommen, ist es Frühling geworden, doch haben wir ihn nicht gesehen. Darum schreiben wir an seiner Chronik auf Deutsch, Persisch und Englisch.
Die Geschichte, von der Roger Callois am Anfang seiner Ars Poetica berichtet, ist anrührend. Es ist bitter kalt und auf einer Brücke sitzt, dem schneidenden Wind trotzend, eine Bettlerin. Sie hat ein Schild vor sich – ein Schild, wie auch wir es in diesen Tagen lesen können – und auf diesem Schild steht in großen Lettern ein Wort: BLIND. Ein Dichter sieht sie, aber hat kein Geld, das er ihr geben könnte und sagt: »Ich kann dir etwas geben, das mehr wert ist als ein Almosen«. So nimmt er das Schild und schreibt einen Satz auf die Rückseite. Plötzlich werfen ihr jene, die vorrübergehen, Geld vor die Füße. Da fragt die Bettlerin, was auf dem Schild stehe. Der Frühling wird kommen und ich werde ihn nicht sehen.
Ein Satz, der diese Geschichte zu einer rettenden Geschichte macht. Denn er zeugt von der Kraft richtiger Worte, also Poesie. Doch er tut auch noch anderes. In ihm sehen wir, dass sich Gesellschaft nicht über Informationen mitteilt, sondern über Gefühle. Gefühle, wie sie ein erster Frühlingstag in uns wachruft, wenn wir uns nur seiner erinnern können. Dies ist die Aufgabe der Frühlingsgeschichten, einer Textur, einer Sammlung von Texten, die bis zum kommenden Frühling von ihm sprechen werden.
Für den Auftakt dieser Reihe kommt Theaterkritiker und Schriftsteller Simon Strauß mit dem Ungar Andor Endre Gelléri (†) ins Gespräch. Zusammen erzeugen sie seinen Abgesang – die Thanatografie des Frühlings – oder aber seine ständige Geburt in den Details. Gelléri wird im Nachwort der Textsammlung Stromern als »feenhafter Realist« beschrieben. Und welche Perspektive wäre dem Frühling näher als diese.
Simon Strauß wird 1988 als Sohn des Schriftstellers und Dramatikers Botho Strauß und der Rundfunkautorin Manuela Reichart geboren. Noch während der Schulzeit ist er Teil einer Gruppe, die sich regelmäßig mit dem Shoah-Überlebenden Rolf Joseph trifft, woraus ein erstes Buch hervorgeht. Aus diesem Anliegen entsteht schließlich der Rolf-Joseph-Preis. Später studiert er Altertumswissenschaften und Geschichte in Basel, Poitiers und Cambridge. Im Jahr 2017 wird er mit einer Studie über die Althistoriker Theodor Mommsen und Matthias Gelzer promoviert. Seit 2016 ist er Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schrieb die Romane Sieben Nächte und Römische Tage und ist Herausgeber von Spielplanänderung!, einem Manifest für ein anderes Theater. Simon Strauß ist ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Andor Endre Gelléri (1906–1945) wird als Sohn eines Schlossers und einer Kantinenfrau in Budapest geboren. Auf Wunsch seines Vaters verlässt er mit 15 Jahren das Gymnasium und absolviert eine Ausbildung an der Industriefachschule. Nebenher schreibt er erste Novellen, die bei Verlegern und Redakteuren auf Interesse stoßen. Leben kann er von seiner schriftstellerischen Arbeit jedoch nicht, und so beginnt er, die verschiedensten Lohnberufe anzunehmen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges bricht die literarische Produktion Gelléris fast vollständig ab.
Als Jude wird er in den Jahren von 1940 bis 1945 in verschiedene Arbeitslager deportiert und schreibt dort nur noch vereinzelt an Fragmenten zu einer Autobiografie. Er muss an einem der Todesmärsche in das KZ Mauthausen teilnehmen und stirbt wenige Tage nach der Befreiung des Lagers im Mai 1945 an einer Typhusinfektion. Neben seinem Roman Die Großwäscherei hinterließ er einen unvollendeten autobiografischen Roman und schuf ein umfangreiches Werk an Kurzgeschichten. »Stromern« ist die Titelgeschichte des gleichnamigen Bandes, der 2018 im Guggolz Verlag erschien.
Andor Endre Gelléri
»Stromern«
Aus dem Ungarischen von Timéa Tanko
STILLE
In jener traumgleichen Zeit sann ich oft über meine brennenden Augen nach. In meinen Gedichten, in denen ich Geheimnissen nachspürte, waren sie für mich Sonne und Mond einer neuen Welt. Mein Blick beleuchtete ganze Felder, meine Lider ließen die Nacht auf die Erde sinken.
Erst spät trübte sich dieses Feuer: Als ich bereits mit stillerem Mut durch meine weltumwälzenden Ahnungen schritt und überall nach dem Boden Ausschau hielt – nach der Tiefe! – und meine Gedanken und mein wirkliches Leben verschiedene Wege gingen – die Gedanken erforschten die Tiefe, und ich taumelte über ihnen benommen durch die Welt.
Das war die Zeit, in der die Worte fürs Leben standen und hinter ihnen alles Platz hatte, Mensch, Wasser, das Bild des Berges, der Zauber Gottes. Manchmal blieben zwei Wörter in mir hängen, standen da wie zwei steile Ufer, zwischen denen ein Fluss hindurchrauscht, und über diese beiden Wörter schmiedete ich hartnäckig Gedankentage lang meine vergänglichen, regenbogenfarbenen Brücken. Meine wichtigste Schwester bei dieser Arbeit war die Stille: Auf ihr ruhte ich mich aus wie Seerosen auf einem Teich. Und da lag ich unter dem großen azurblauen Gewölbe unter dem Druck der Stille, die allmählich zu rascheln und zu flimmern begann.
Ich weiß noch, damals glaubte ich nicht ans Jenseits: Hungernd, der Faulheit bezichtigt, sehnte ich mich nach einem Traumleben auf Erden, nach himmlischem Sein.
Die jungen Jahre vergingen, und ich glaubte immer weniger an meinen geheimen Wunsch, ich dachte: Würde es dieses Leben geben, so hätte ich es erreicht. Und um mich herum hungerten selbst die Arbeitenden so sehr, dass für die Träumer nichts mehr übrigblieb. So blies das Horn einer Kleinanzeige seine Melodie durch meine betrübte Seele:
Herren mit feurigem Blick gesucht
Obgleich ich bisher jede Gelegenheit zur Arbeit von mir geschoben hatte, dachte ich mir, meine Augen könnten ruhig eine Anstellung annehmen. Verzweifelt wie ein Verurteilter ging ich im schneidenden Morgenwind zu der angegebenen Adresse.
Empfangen wurde ich von einem erschöpften Treppenhaus, dessen Holzstufen mich bis zum Büro hinaufhoben, das eng und weiß war wie eine Papierschachtel. Stumm betrat ich es: Am Schreibtisch fläzte sich, den Kopf auf die Hand gestützt, ein Herr mit grauen Haaren und funkelndem Blick: der Chef. Ich bemerkte andere verzagte Herren mit feurigem Blick, die im Halbkreis um den Tisch standen, auf zertretenen Absätzen, eine Schulter tiefer als die andere, und auf dem Grund dieser Haltung hingen prall gefüllte Ledertaschen. Als wollten sie verreisen, und sie schwiegen wegen des traurigen Abschieds. Nur einer zeigte einem anderen, wie viel Platz zwischen seinem Hals und dem Kragen sei, wie viel er in diesem heißen Sommer abgenommen habe. Das Feuer ihrer neugierigen Augen flackerte, und mich schauderte es, als läuteten tote Glocken in meiner Brust. Sie waren müde, schliefen beinah, nur ihre Augen leuchteten wach. Ich suchte nach jemandem mit matterem Blick, doch kam ich dabei vom Feuerberg in den Vulkan, sah nur Kometen zwischen den weit aufgerissenen Lidern. Das war also das Büro der Firma, die die Augentropfen Königin der Blicke verkaufte. Diese hat mich mit der ungewöhnlichen Anzeige aus meiner Einsamkeit gelockt. Sie verlangte nicht mehr von den Herren, als einen feurigen, fiebrigen Blick.
So bekamen meine Augen eine Anstellung, durch die ganze Stadt sollten sie ziehen: Als zwei lebende Plakate wurden sie engagiert, mit ihnen meine glänzenden Träume, und all das für ein wöchentliches Fixum von zwanzig Pengő und fünfzehn Prozent Provision.
Nach einer nur zweistündigen Einweisung stand ich draußen auf dem Kopfsteinpflaster und blickte in die Straße; mit der Vertretertasche in der Hand hatte ich das Recht, überall anzuklopfen und den, der mir die Tür öffnete, leuchtend anzusehen. Nur diesen Blick wolle ich den welken Damen vorführen …
Als es Mittag wurde, wusste ich bereits, dass nicht mehr zu meinem Handwerk gehörte als eine Verbeugung, ein Handkuss … eintreten … und dann wieder hinaus … Oder seelenlos muntere Ausrufe: »Aber gnädige Frau, für nur zwei Pengő könnten Sie einen Diamantenblick bekommen! Und für drei Pengő erstrahlen Sterne, ganze Himmelssphären in Ihrem liebreizenden Gesicht!«
An meinem ersten Abend als Handelsvertreter löschten Tränen das Feuer meiner Augen …
Und dann … nun ja, ich blieb in der Truppe der feurig Blickenden, wurde ihr Kollege und verkaufte ihnen gleich das Feuer, meinen ständigen Gefährten, und ich muss zugeben, damit verdiente ich mehr als mit meinen Träumen. Wenn ich mich jedoch auf meinen ungläubigen Wegen ab und an in einen Park am Fluss verirrte, lehnte ich mich halbblind an die Rückenlehne einer Bank; sogleich senkten sich meine Lider wie der Vorhang am Ende einer Vorstellung, und ich murmelte im Halbschlaf: »Nun hast du also deine Sonne verkauft, und deinen Mond gleich dazu …«
Alle knatternden Handelsworte kamen zu mir zurückgeflogen, und ich musste gegen sie kämpfen; das fortwährende »Küss die Hand« und das Grinsen … mein Gott … meine Vertreterfüße schmerzten, und meine Zehen suchten sich ihren Weg durch die Löcher in den Strümpfen. Manchmal wollte ich alte Gedichte aufsagen, doch sogleich überkam mich Scham. Und auch wegen der anderen lautlos umherwandelnden feurigen Augen konnte ich nicht recht einschlafen, die Schreckensbilder der hängenden Schultern, der Lärm ihrer krummen Füße, die durch die Straßen schlurften. Immer wieder raffte ich mich auf und machte mich erneut auf den Weg.
Aber heute, dachte ich, heute lass ich euch, ihr Traurigen, allein herumziehen, ich setze mich hier in diesen stillsten aller Parks. Nach den lauten, heißen Monaten setze ich mich endlich, und es wird ein Abend wie früher sein. Geschäfte kann ich jetzt ohnehin keine mehr schließen; es dämmert bereits, die Blätter werden dunkler. Und dieser Park ist so einsam rund wie ein magischer Kreis, in dem nicht einmal das Laub spricht. Auf den wenigen Bänken ruht sich nichts aus, außer den matten Farben.
Dieser Park gehört mir, ich strecke mich, er besänftigt mich mit seiner Ruhe; er hat seine Lufttore hinter mir geschlossen und lässt niemanden eintreten. Hier werde ich wiedergeboren; die dunklen Fluten der Luft waschen meine schweißnasse Stirn. Der größte Lärm ist ein Seufzen, das aus meiner Brust aufsteigt. Und vielleicht hebt mich der Abendwind aus meinem müden Körper, trägt mich fort und baumelt mich zwischen den Baumkronen hin und her. Die Stille deckt mich zu, in diesem Halbschlaf läuft ein weißer Engelsarm an mir vorbei; jetzt müsste man ein Zauberer sein: Der Tod betrachtet die dunklen Bäume; jetzt müsste man dem Durstenden einen Fluss zu trinken geben; denen, die keine Beine haben, Berge zum Gehen verleihen; erzählen … den Toten mit der Farbe eines Topas’ zum Leben erwecken. Das Herz sehen, zu dem durch die Adern des Weltalls Sterne eilen und in das sie ihr Feuer als lebensspendendes Blut träufeln. Gott als gewaltiges Herz erahnen: Vom Scheitel bis zur Sohle, vom Himmel bis zur Erde schlägt und pulsiert er, empfängt Blut und verteilt Blut. Es wird der Tag kommen, an dem auch dieses Herz kraftloser schlagen wird: Die Sterne werden als Greise zu ihm strömen, und irgendwann wird es erschrocken zum letzten Mal schlagen. Aber jetzt ist die Welt noch so geräuschlos wie eine riesige Glocke, in der sich die Sonne versteckt, um gegen die Bronze der Morgendämmerung zu schlagen und den Menschen zum Gebet und zur Arbeit zu rufen!
Meine Arme ruhen glücklich ausgebreitet auf der Rückenlehne, der Kopf fällt mir träumend auf die Brust. Es tagt schon sanft, und mein unruhiger Atem nimmt den frischen Tau wahr. Ich trinke den sonnenstrahlenbestäubten Duft dieses Gartens und lausche dem nächtlichen Geruch, wie er mit dem neuen Wind von den Gräsern weicht. Blass beobachte ich, wie die himmlischen Ahnungen über mir Farbe und Licht ändern. Wie ein Jesus hänge ich gegenüber der Sonne, die die Wolken anmalt; unter mir öffnen sich bereits die Blumenhöhlen und richten sich die Grashalme auf. Die Sonne funkelt und wächst stumm, und ebenso gehen die riesigen Sterne neben ihr unter. Das Wunder unseres Lebens kommt und geht auf Zehenspitzen, und wie ich den Himmel betrachte und das sehe, kommt mir der schmerzliche Gedanke: Die großen Wunder bewegen sich lautlos, fern von der Welt, und verstecken ihre Göttlichkeit hinter dem Geheimnis der Stille. Das verrät mir die stumm aufgehende Sonne, die sinkenden Sterne ermahnen mich, ebenfalls zu schweigen, und locken mich zu einem Leben fern von der Erde.
Ich will diesen Park auf Zehenspitzen verlassen, vorsichtig, denn die Straßen sind noch von Glas bedeckt, und auf diesem rutschigen Kristall taumeln die Betrunkenen traurig. Aber jetzt knarrt das erste Rad, dreht sich um die ungeölte Achse wie sich die Erde aus der Nacht in den Tag, aus der Stille in den Lärm dreht. Und überall öffnen sich die Fenster, aus denen zusammen mit der Luft der bösen Träume, dem Geruch der Liebe, der heisere Husten der Menschen und die ersten aus dem benommenen Schlaf aufschreckenden Worte entweichen. Die wilden Pferdehufen zerbrechen schon den Silberbezug der Straßen … ach, welcher Lärm das Erwachen des Menschen begleitet: Am Himmel ist eine Sonne geboren, und niemand hat es gehört …
Ich hebe meine Tasche, und wie kleine Glocken, die dazu bestimmt sind, mich zu wecken, klirren die Fläschchen mit den Augentropfen. Es ist, als leuchteten mich aus der Tasche heraus plötzlich all die Augen der Kurtisanen an, die heute durch diese Tropfen erstrahlen werden … Ich gehe auf sie zu, und neben mir fährt die Pferdetram durch die neblige Luft, mit ihrem einzigen roten Auge blickt sie nach vorn, und dann sind da noch die großen trägen Pferdeaugen, die mich begleiten.
RAUSCH
Der Frost ist da. Vor Kälte zitternd tauchen wir die schweren Kleider ins eisige Wasser. Wir lassen gerade Dampf in die tanzenden Färbekessel, als eine in weißen, jungfräulichen Pelz gekleidete Dame zu uns hinauskommt. Unsere Geschäftsleiterin steht neben ihr und sagt höflich:
»Die Baronin!«
Mein Lehrgeselle drängelt sich sogleich zu ihr vor. Auch ich wende mich ihnen mit verzauberten Augen zu. Und ich sehe, dass die Baronin wohl ein wenig närrisch ist, denn sie kneift den Arm des Gesellen mit zwei Fingern und sagt: »So fleischfarben soll die Seide werden. Wie sein Arm.«
Mit einem Satz bin ich bei ihnen. »Nicht vielleicht lieber wie dieser?«, frage ich und strecke ihr meinen schweren Arm entgegen.
Die Baronin sieht ihn sich an und zuckt mit den Schultern: »Das ist auch nicht hässlich.«
Und schon verschwinden die beiden …
Wir sehen uns eifersüchtig an, aber dann bricht das große Zwicken aus: So soll es sein – nein, genau so!, rufen wir.
Und vor lauter Freude läuten wir mit unseren Färbestäben auf den Kesseln eine heilige Messe: Ging-gong-ging-gong.
Wir entscheiden uns für meinen Arm als Muster, den ich meinem Lehrgesellen unter die Nase halte. »Katesin«, sagt er, nachdem er einen Blick darauf geworfen hat, und schon mischt er das Braun.
»Und eine Prise Kongorubin«, sagt er dann, wodurch das Braun einen Purpurstich bekommt.
Er ergötzt sich am Anblick der Seide, die sich im heißen Wasser aufbläht. »Das wird schön«, sagt er und schnalzt zufrieden mit der Zunge. Und für eine Weile löst sich der Winter auf. Auch unsere Wangen färben sich rot, und wir kosten alle Nuancen der Farbe aus. Dabei lässt der Dampf die Kupferkessel erklingen, zittert über ihnen in der Luft, und in den Erscheinungen, die dem Brodeln entsteigen, sehen wir grünen Regen, wenn wir grünfärben, roten Schauer, wenn wir rotfärben; blauen Nebel, gelben, goldenen, violetten.
Und unser Färbeschrank sieht uns mit seinen Zinkbehältern wie eine Farbgrube an: Wir greifen mit unserem kleinen Rührlöffel in einen der Behälter, und schon bringen wir den Frühling, den rostroten Herbst … Sieh an, Götter sind wir, wir sind die Natur! Wann werden wir einen neuen Mond an den Himmel malen?
Doch übers Schwärmen vergessen wir die Arbeit. Wir erschrecken und machen uns eilig ans Werk, hurtig, hurtig! Um das Gewicht der Tuche festzustellen, werfen wir sie in die Luft: »Für diese Trauerfärbung brauchen wir vier Löffel Napthylaminschwarz.« Wir rühren, kochen, gießen Ameisensäure in den Kessel, weiter so, weiter!
Dann ist das Färben für heute beendet. Wir haben bereits alles in den heißen Trockenraum gehängt. Und nun stehen wir mit saurer Miene in der Benzinkammer. Seit heute Morgen schieben wir die Reinigung von einem Korb Kleider vor uns her; lauter Seide, lauter festliche Lumpen, aus denen nur Benzin die Flecken holt. Wir werfen einen blinzelnden Blick auf das Thermometer: Es herrschen siebenundzwanzig Grad Kälte. Ist das in den V-förmigen Zinnbehältern schillernde Benzin womöglich bis zu vierzig Grad abgekühlt? Wenn wir unsere Hand auch nur eine Minute darin lassen, friert sie ab!
Am Morgen war uns zu kalt, um diese Aufgabe anzugehen; das Waschen mit viel Seifenschaum neben den warmen Waschmaschinen war da schon angenehmer. Mittags haben wir es auch lieber sein lassen: Das Benzin hinterlässt einen schalen Geschmack im Mund, es ist, als hätte man das Essen in Petroleum getränkt. Und jetzt kommt ein eisiger Wind auf; der Himmel erscheint mir wie ein auskühlender Toter und verströmt immer grauenhaftere Kälte. Qualvoll sehen wir uns an: Wer soll als Erster die Hand hineinstecken? Wessen Hand soll erfrieren? Unser beider Hände, oder nur die meine, da ich der Lehrjunge bin?
Es kommt ein Mädchen angerannt und stottert: »E-e-s kommen … fr-fr-fremde Gäste, a-a-alles muss in O-O-Ordnung sein!« Es kommen also Gäste von weither, um zu sehen, wie uns die Hände abfrieren! Um durch Augengläser mit kühlem Blick die Wasserfilteranlage, die Waschmaschinen und den funkensprühenden Dynamo zu begutachten. Die unter Ächzen vollbrachte Arbeit, den Reichtum des Herrn Betriebseigentümers …
Unsere Verzweiflung kennt keine Grenzen. Das Benzin hockt in den Zinkbehältern, sieht uns mit Schlangenaugen an und haucht uns seinen berauschenden Atem entgegen. Wir warten, dass er uns trunken macht, damit es nicht so schmerzt, wenn wir hineinfassen, damit wir nicht wissen, wann uns das Benzin die Finger mit seiner Eiseskälte abschnürt. O weh! Wir haben die Bürste fallen lassen! O weh! Schon sind unsere Finger zehn starre Zweige. Die Kälte fährt uns in die Knochen. Wir heben die feuchten Kleider mit schmerzoffenem Mund aus der Flüssigkeit. Und dann glauben wir, wir schreien und fluchen, dabei können wir uns gar nicht mehr rühren: Wir sind betrunken. Wenn wir uns setzen, um uns ein wenig auszuruhen, und dann taumelnd aufzustehen versuchen, um mit der Arbeit fortzufahren, ist es, als würde das Sitzen in uns an der Bank klebenbleiben, es trennt sich von uns wie ein bleierner Schatten, und wir sehen es fröstelnd an: Ihre Exzellenz, hochgeachtetes Sitzen, erheben Sie sich doch bitte! Dämlich schwanken wir in dem engen Käfig.
Die kahlen Fenster uns gegenüber tanzen, und wir wissen selbst nicht warum, aber wir spucken in ihre Richtung und rufen:
»Blumen zu verkaufen, kaufen Sie Blumen!«
Wir lachen wie Baumstümpfe. Und verstummen erschöpft. Dann blicken wir erschrocken zu dem unsichtbaren Brandstifter und rufen ihm zu: »Um Gottes Willen, hier ist es verboten zu rauchen!«
Die Stille im Gebäude wird uns verdächtig, wir wollen von den Zinkbehältern wegrennen, vielleicht ist ja ein Riemen gerissen … Die Stille bedeutet Gefahr, womöglich lodern die roten Flammen bereits ganz nah.
Die Wut auf unseren Chef wächst und wächst; wir unterbrechen die Arbeit und schimpfen über ihn.
»Die Frauen hier sind so leichtblütig«, sage ich von Gram erfüllt, das Herz wird mir ganz schwer, denn in letzter Zeit lebe ich allein.
»Alle gehören sie dem Chef«, erwidert der Geselle blass.
»Für uns bleibt keine mehr übrig, alle fischt er uns weg«, fahre ich wütend fort.
»Sogar Anna.«
»Dabei liegt ihr Vater im Krankenhaus, nur deshalb muss sie jetzt hier arbeiten.«
»Auf den Dachboden hat der Herr Direktor sie geschickt!«
»Es kümmerte ihn nicht, dass sie bitterlich weinte!«
»Der kümmert sich um nichts, schleppt nur seinen großen Kopf durch den Tag.«
»Er saugt uns das Leben aus … wir riskieren unser Leben für nichts … für diese Arbeit hat er nicht einmal eine Genehmigung, und wenn hier etwas explodiert, kann das gesamte Haus einstürzen … dann fliegen wir bis zum Himmel … dass noch niemand seinem Hirtenhundgesicht einen solchen Schlag verpasst hat, dass es anschwillt … dass ihn noch niemand so in den Bauch getreten hat, dass ihm der Schuh steckengeblieben ist … dass ihm noch niemand den Kneifer von der Nase gefegt hat!«
»Wenn er jetzt herkäme, würde ich ihn ins Benzin tauchen!«
Und ich sehe viel Fett, das sich schnaufend vom dreckigen Boden erhebt und auf ein schlotterndes menschliches Skelett zubewegt. Das Fett hält sich mit weichen Fingern an ihm fest, die verstopften Adern winden sich und keuchen, und das Fett ächzt vor Anstrengung. Das Skelett kracht und knackt, aber das Fett an ihm wird mehr und mehr … Stunden vergehen … und vor mir steht ein dem Dreck entwachsener Fettmensch: der Herr Direktor. Er hat keine Farbe, nur das Gelb von Gänsefett, und er öffnet seinen schwefelfarbenen Mund, um den Schöpfer um Farben zu bitten, hinter denen er sein Fett verbergen könnte.
Er blickt in die Kirschfarbe des Sommers und will sie für seine Wangen entwenden.
Er blickt in das blaue Wasser des Bachs und will es sich in die Augen locken.
Seine Haut würde er am liebsten in der Morgendämmerung baden.
»Nein! Nein! … Rache!«, sage ich. Der berauschte Geselle sieht mich mit gequältem Grinsen an und stimmt mir zu: »Rache!«
Und schon bringen wir die benzingereinigten Sachen weg zum Trocknen … wir laufen am glühenden Kesselhaus vorbei … pfeifen dem verrußten Heizer zu, dass wir kommen … er pfeift zurück … schwerfällig gehen wir weiter … die Dynamobürsten sprühen Funken: Das jagt uns einen Schauer über den Rücken, nicht, dass sich das Benzin entzündet … nichts passiert … und wir gehen in die verschlossene Benzinkammer, wo wir die Wäsche aufhängen. Wir lassen das berauschende Gas, das sich in ihnen versteckt, nicht wie sonst entweichen, sondern atmen es ein … Und ach, unsere Adern fliegen davon, und unser Kopf schwebt über uns!
Als es dämmert, schleichen wir taumelnd hinaus und drehen den zischenden Dampf ab. Von drinnen antworten die Maschinen unseren vollgestopften Ohren lediglich mit dem dumpfen Rauschen des Schaums … bei uns kehrt mit dem Abend eine große Stille ein … Wir wissen, bevor die Gäste kommen, wird der Herr Direktor durch den gesamten Betrieb eilen und fragen: »Herrscht auch überall Ordnung?«
»Bei uns herrscht Ordnung!«
Denn an der Tür zum Hof hängt ein starkes Kabel, und die Lösungen all der nicht abwaschbaren basischen Farben können es auch kaum erwarten, sich nützlich zu machen. Das saure Cyanin steht neben dem purpurnen Rhodamin, dem Malachitgrün, und im Kessel schwimmt beißend warm das Pechschwarz!
»Rachearmee, stillgestanden! Stillgestanden vor den trunkenen Färbern!«
Und die Farben stehen still, beugen sich aus ihrem Zinkkleid heraus und sagen: »Zu Befehl!«
»So ist es gut, ihr treuen Soldaten!«
Unsere Augen tauchen in den großen Kessel mit der schäumenden schwarzen Farbe ein: »Du heißes Schwarz, kühle ja nicht aus!«
»Zu Befehl, ihr trunkenen Färber, ihr mutigen Färber!«
»Ihr habt recht, Farben, wir sind die mutigen Färber! Und trotzdem spricht er mit uns von oben herab. Er! Der uns die Geliebten aus dem Schoß reißt!«
Und schon geht die Tür auf. Ich habe ein Papierknäuel in der Hand und ein Tuch, das den Mund verstummen lässt, alle Töne verschluckt. Der Geselle steht neben dem Kabel.
»Der Herr Direktor!«
Wir zögern nur einen Augenblick lang … Das Kabel verschließt die Tür … wir bewegen uns trunken, ringen taumelnd und doch geschickt mit dem Mann … nach wenigen Minuten steht der Herr Direktor mit zugebundenem Mund, wehrlos, nackt, behaart vor uns.
»Rasch, an die Arbeit! Die Gäste kommen!«
»Malachitgrün!«, ruft der Geselle.
»Kommt sofort.«
Von der Farbe, mit der wir ihn bespritzen, wird der Herr Direktor ganz grün im Gesicht.
»Auramin … Ja, das passt.«
Nun ist er gelb bis zu den Wangen, und in seinem fetten Doppel(-)kinn vermischen sich Grün und Gelb.
»Das rote Irisamin!« Oh, wie sein Hals von der Farbe blutet, oh, das rote Irisamin!
Wir malen und malen.
»Den Arm machen wir lila! … dann den Schnurrbart … und den Bauch, den dicken Bauch.«
Grölend bepinseln wir die aufgedunsene Trommel, in der Mitte rot, drum herum kornblumenblau und an den Seiten gelb.
»Hau ruck!« Wir setzen ihn in die beißend schwarze Farbe.
»Ach, du Schwarzbein! Du Mohr!«
Den Rücken lassen wir weiß.
Zum Schluss malen wir noch hier und da voller Genuss verschnörkelte Muster. Außer Atem betrachten wir unser Werk: Was für ein hässlicher Affe, ein Stieglitz, ein dummer Pfau du doch bist, lachen müssen wir über dich, du Hampelmann.
Mit saurer Miene sieht er uns an, diese lächerliche, groteske Gestalt.
Wir nehmen die Färbestäbe, die wir uns aus Tünchpinseln zurechtgeschnitten haben. Dann öffnen wir die Tür vor ihm.
Aber wir halten ihn noch zurück. So lange, bis die Schar der ausländischen Gäste sich im Bügelsaal versammelt hat und schnatternd die dampfenden Bügeleisen, den klappernden Kragen(-)markierer betrachtet und sich schreiend in den verschiedensten Sprachen unterhält.
Die Geschäftsleiterin blickt sich bereits suchend um, wartet mit süßem Lächeln, wann denn der Herr Direktor auftaucht … alle warten auf ihn … Engländer, Deutsche, Italiener, Franzosen …
Dann mal los … Wir reißen ihm den Knebel aus dem Mund … er stöhnt auf … auch Hände und Füße befreien wir ihm und peitschen ihn mit den Färbestäben: »Hü!«
Die kunterbunte Gestalt stürmt in den Raum, stolpert, klagt, landet mitten zwischen den Gästen, die sie zunächst verblüfft betrachten, dann vor Ablehnung und Fassungslosigkeit erstarren.
Wer ist das, der zwischen den Maschinen, aus der Kälte, den Qualen der Arbeiter ausgebrochen ist? Wer ist das, dem die Beine so zittern, dass sie einzuknicken drohen, und der wie ein Wahnsinniger ruft: »Ich bin der Chef, der Chef bin ich!«
Wer sind diese Arbeiter, die uns hier anstarren? Auf wen hörten sie, als sie das taten?
Der erbärmliche Kerl liegt bereits ohnmächtig vor uns auf dem Rücken, sein Bauch ragt blau-rot-gelb nach oben, und die Frauen verbergen ihr Gesicht vor seiner Blöße, rennen weg, bis der Heizer ihn schließlich mit einem weißen Laken zudeckt.
Wir werfen unsere Färbestäbe zwischen die zurückweichenden Gäste, rennen mit bitterer Wut davon, ergreifen noch rasch unsere Kleider und Schuhe, klettern über den Zaun und poltern in den Holzpantoffeln über das Kopfsteinpflaster.
Der Wind weht eisig, rüttelt unseren nüchternen Verstand wach. Der Gedanke daran, dass wir von nun an verfolgt werden und im Elend fliehen müssen, raus aus der Stadt, raus aus dem Land, lässt uns die Tat bereits bereuen … Ich werde nicht freigesprochen, und mein Geselle wird mir die Schuld dafür geben, wenn wir für unsere berauschte Tat mit Hunger werden bezahlen müssen … und doch, als wir zu Hause ankommen, lachen wir laut in dem kalten Zimmer und rufen:
»Dieser Dickwanst! Das Schönste war seine fette Wampe!«
EIN FILLÉR
Gegen sechs Uhr kroch ich aus der Ziegeltrocknerei hervor. Ich befeuchtete meine trockenen Lippen mit der Zunge, kämmte mir mit den Fingern den Ziegelstaub aus den langen Haaren … dann machte ich mich von meinem kostenlosen Nachtlager auf den Weg zum Fabriktor an der Bécsi út. Aus dem Wiegehaus ragte ein Wasserrohr heraus: Mit nacktem Oberkörper stellte ich mich darunter und musste lachen, als mir das fröstelnde Wasser in die Hose hinunterrann.
Durch das Waschen erfrischt, verließ ich das Fabrikgelände und setzte mich an den Rand des Straßengrabens. Das am Boden träge dahinfließende Wasser sah ganz ölverschmutzt aus.
Die Sonne stand immer runder über der Lehmkuhle und übergoss die Grubenhunde mit Licht. Ich dachte mir, später könne ich ja noch zur Donau gehen, aber vorerst sei es gut, am Rand des Straßengrabens zu bleiben, vielleicht würden an dem Tag noch Arbeiter für die Bergarbeit gesucht. Bis dahin konnte ich ja die Langeweile vertreiben, indem ich mit meinem alten Glücksfillér spielte. Ich kramte ihn aus der Tasche, drehte ihn, besah mir die Ränder, ließ ihn von der Spitze des Zeigefingers ins Tal der Handfläche rollen … neben mir lag eine mit einem Schuhabsatz abgestempelte Ausgabe des Tagesblatts Az Est ; ich zog sie zu mir und las zerstreut: »Die Rückkehr des … rumänischen Königs« dann nahm ich einige liederliche alte Streichhölzer mit verrußten Köpfchen an mich und schielte zu den gelben Blüten des Löwenzahns hinüber.
Unter mir schwammen kleine, an Würmer erinnernde Fische, mit ihren winzigen Nasen schlugen sie sanfte Wellen, und wie vom erwachenden Gras aufgescheucht, flogen Schmetterlinge in die Lüfte.
Mit meinen dem Spiel entwachsenen Fingern faltete ich aus dem dreckigen Zeitungspapier ein Boot. Oft musste ich innehalten, wie ein alter Schiffszimmerer: Was genau war der nächste Schritt? Nachdem ich die Seiten mit den Bleibuchstaben einige Male gewendet hatte, stellte ich meine fertige Fregatte ins Gras.
»Mein kleiner Fillér, mein Schatz«, sagte ich zu der Münze, »jetzt bekommst du zwei Streichholzbeine und einen Streichholzkopf mit rußschwarzen Haaren, aus meinem Mantel reiße ich ein Stückchen Faden, mit dem ich dich wie einen Odysseus ans Löwenzahnsegel binde.«
»Gute Reise, Fillér, mein Kleiner«, sagte ich zum Abschied.
Dann stand er, Herr Fillér, an Deck, der Wind blies ins gelbe Segel und die Fregatte fuhr langsam los … am besten wäre es, mich hinterherzustürzen und mit meinem letzten Schatz am Boden der Pfütze zu versinken.
Plötzlich wurde ich vom ersten Tuten der Fabrik aufgeschreckt. Über mir setzten sich die Grubenhunde in Gang: Manche fuhren mit Sonnenlicht beladen in die Grube, manche kamen mit Lehm beladen zu den Ziegelpressen. Ein stumpfes Dröhnen war zu vernehmen; es wurde mit Dynamit gesprengt, große Stücke der Lehmmauer brachen ab.
Ich sprang über den Straßengraben und rannte zum Büro. Ich wusste, was da stehen würde, und doch ging ich ganz nah ans Fenster und las das Schild:
HEUTE KEINE AUFNAHME VON ARBEITERN.
Ich steckte die Hände sofort in die Hosentaschen, meine Arme sollten sich so wenig wie möglich bewegen und Kraft sparen. Auch hätte ich gerne meine erschöpften Beine, zusammen mit meinem verzagten Leben in die Tasche eines Riesen gesteckt. Ach, wie gerne hätte ich den Boden einer Küche aufgeleckt, ja, mit der Zunge aufgeleckt, hätte man mir nur endlich eine Arbeit verschafft.
Ich dachte daran, trotzdem in die Werkstatt zu gehen, mich an den Schraubstock zu stellen, die Raspel zu nehmen und einfach drauflos zu arbeiten. Wenn mich jemand wegschicken wollte, würde ich ihn gar nicht beachten, nur raspeln, raspeln, bis spät in die Nacht. Ein wenig Lohn würde man mir dafür doch sicherlich geben.
Ich ging und betrachtete meinen mageren Schatten; mir erschien es, als gäbe es links und rechts von mir unzählige solcher Schatten, von denen der Wind ab und zu einen fortwehte, hinauf zwischen die dunklen Wolken:
Sie sind gestorben, dachte ich ohne große Erschütterung.
Ich ging zu der Litfaßsäule mit den Stellenangeboten. Die Brücke hatte ich bereits hinter mir gelassen, ebenso die glänzende königliche Burg. Wie gut es wäre, dachte ich, eine Lampe in der Burg zu sein! Ein Thron oder … nein, das wäre nie möglich … ein Koch!
Da musste ich ans Frühstück denken und riss unwillkürlich ein paar grüne Grashalme von den Kaffeehausterrassen. Manche waren trocken und ein wenig bitter, es gab aber auch so manchen süßen unter ihnen. Ich war nicht sehr wählerisch: Ich riss sie ab, spuckte sie aus und starrte dabei in die trüben Fensterscheiben. Ich sah in ihnen zu hochgewachsen aus, hatte einen nur faustgroßen Kopf, erinnerte durch die Kaubewegungen an ein Nagetier.
Hinter den Fenstern erblickte ich den Handelsgehilfen, was mir das Herz zusammenschnürte. Statt der Arbeit kamen auf mich immer nur die vielen wirren Gedanken zu, und das nun schon seit dem fünften Monat. Wie gerne ich unter jeder Last ächzen würde, möge sie noch so schwer sein … Ich werde noch verrückt in dieser Untätigkeit! Vielleicht sollte ich mich an einen Baum lehnen, und wenn mich jemand fragt, warum ich seit Monaten hier stehe, flüstere ich ihm zu:
»Ich warte darauf, dass ich Wurzeln schlage.«
Wie entsetzlich es ist, eine Idee auf die andere zu häufen. Aber was soll ich tun: Wenn ich diesen Seelenzirkus schließe, wenn ich die sonderbaren gelben Lampen darin lösche, bleibt mir nichts mehr als die Donau oder der trockene Ast eines Baumes im Hűvösvölgy.
Matt lehnte ich mich an die Wand und las die Anzeigen. Ab und zu rempelte mich einer an, ich rempelte ein bisschen zurück, doch blieb ich dabei in meiner bequemen Position, schließlich winkte ich resigniert ab, drehte mich um, ging los, spuckte aus, noch einmal und noch einmal.
Als ich damit fertig war, blieb ich stehen, starrte vor mich hin, was sollte ich nun tun?
Ich zuckte zusammen und blickte nach unten, wo eine kleine Gestalt mit dunkelbraun gebranntem Gesicht stand und an meinem Hemd zupfte.
»Spucken Sie ruhig«, sagte er ernst.
Ich ließ mich nicht lange bitten.
»Warum ist das grün?«, fragte er und zog seine Katzenaugen zusammen.
»Grün? Ach, so, ja«, sagte ich und schlug mir mit der Hand an die Stirn. »Weil ich auf dem Gras vor den Kaffeehäusern herumgekaut habe.«
»Sehen Sie mal her, Kollege, Abrakadabra«, sagte er, bewegte die Hand wie ein Zauberer und spuckte aus.
»Und warum ist es bei Ihnen gelb?«, fragte ich ihn lachend.
Er zuckte mit den Achseln.
»Wohl, weil ich an Zweigen kaue.«
»Ach so«, erwiderte ich und seufzte. »Haben Sie auch keine Arbeit?«
»Schon lange nicht mehr. Und seit wann sind Sie brotlos?«
»Seit langem.«
»Würde doch nur endlich die Regierung gestürzt werden«, sagte ich.
»Würde ich doch auf der Straße nur längere Stummel finden«, erwiderte er.
»Eine Bank zu überfallen, wäre aber auch nicht das Letzte, oder?«, fragte ich.
»Sie würden einen doch sowieso gleich erwischen.«
»Das stimmt schon, es gibt ja mehr Polizisten als Fliegen.«
»Hopp«, sagte ich und wechselte zum Du, »auf deinem Ohr sitzt auch eine.«
»Hopp, und auf deiner Nase ebenso.«
Wir besiegelten das Du mit einem Handschlag und gingen zusammen weiter. Er bückte sich manchmal, um einen Zigarettenstummel aufzuheben; und ich hätte gerne eine unbenutzte Fahrkarte für die Straßenbahn gefunden, mich in einen Wagen gesetzt und den Bierbrauereien in Kőbánya einen Besuch abgestattet.
»Hast du nicht ein bisschen Geld?«, fragte er plötzlich.
»Ich hatte einen Fillér.«
»Wo ist er?«
»Ich habe ihm ein Schiff gebaut und ihn zum Kapitän ernannt. Er hat von mir zwei Streichholzbeine, einen Streichholzkopf und ein Löwenzahnsegel bekommen.«
»Aber wo ist er?«, fragte er erneut, »das sollst du mir verraten … denn ich habe auch einen Fillér … und für zwei bekomme ich schon eine ganze Dráma !«
»Auf der Bécsi út«, antwortete ich ihm in einem Ton, als würde ich ein Märchen erzählen, »weit weg … und wenn er nicht schon untergegangen ist, dann schwimmt er in einem Straßengraben.«
»Auf der Bécsi út? Beim Straßengraben neben der Ziegelei?«
»Ja, ja«, sagte ich, »aber warum bist du so aufgeregt?«
»Du dummes Pferd«, rief er laut, »na, weil ich hingehen und sehen will, ob ich ihn finde. Wenn ja, kann ich eine ganze Dráma rauchen!«
Also war ich wieder allein unterwegs. Der kleine Misi (denn das war sein Name) hatte sich auf den Weg nach Óbuda gemacht; »Vielleicht finde ich ja unterwegs noch einen«, hatte er gesagt und ist losgegangen … Mir sollte es recht sein. Sein Spuckkunststück war lustig, aber ansonsten war er ein kleiner Bauer, der mir die Haare vom Kopf gefressen hätte.
Es war Mittag. Ich plünderte erneut die Kaffeehausterrassen. Doch schenkte ich meinem Speichelgeschoss nun mehr Aufmerksamkeit. Grün, grün … ich blickte zu Gott und frage ihn seufzend:
»Mein Herr, wann werden endlich Schinken, Fisch und Sahne meinen Speichel färben?«
Ich setzte mich auf eine verstaubte Bank. Hier ruhte ich mich vom einen Glockenschlag bis zum nächsten aus und schrieb mit Streichhölzern auf die Bank: Hier saß A. E. G., 4. Juli 1930.
Wie wäre es, meinen Abschiedsbrief auf so eine Bank zu schreiben? … Würde ihn der Wind verwehen? Würde sich jemand draufsetzen?
Timea Tankó wird 1978 in Leipzig geboren und verbringt ihre Kindheit in Ungarn und Deutschland. Seit 2003 übersetzt sie ungarische Literatur ins Deutsche, unter anderem Antal Szerb, Krisztián Grescsó, Miklós Vajda, István Kemény und Andor Endre Gelléri. Wir danken ihr und Sebastian Guggolz vom Guggolz Verlag, dass wir diesen Text als Teil dieser Textur lesbar machen dürfen.
Video und Produktion: Holm-Uwe Burgemann
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.