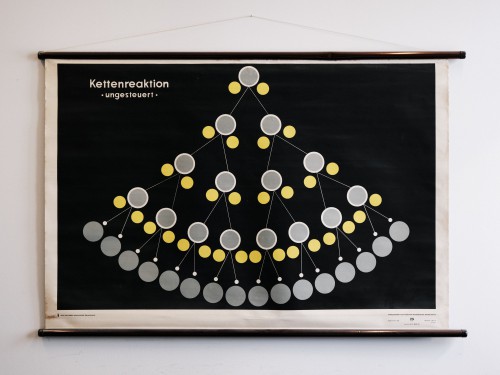ZUFÄLLE, UNKLARE ABSICHTEN UND SEHR WENIG VORSÄTZE
Wir lernen einander kennen, während Joseph Vogl an der Ostküste ist. Die Universität in Princeton ist zu einer Zuflucht geworden, an die er als »Permanent Visiting Professor« zyklisch gebunden ist. Durch das Fenster des Bildschirms sehen wir einander an und haben doch ungleiche Aussichten. Er, in seinem gemieteten Appartement, das für Durchreisende gebaut zu sein scheint; sofern wir dem namenlosen Interieur glauben, das seinen Kopf rahmt. Wir, an einem Flussufer, auf Paletten sitzend. Wir antworten ihm irgendwann, dass wir PRÄ|POSITION durch seinen Freund Roger Willemsen machen. Von dieser »Urszene« habe er nicht gewusst, schreibt er später, als er zusagt.
Als wir uns daraufhin in Berlin treffen, ist er wieder nicht, ist er noch nicht, da. Oder nicht offiziell. Denn gerade aus Princeton zurückgekehrt, verzögert er die institutionellen Pflichten zugunsten eigener. So bewegen wir uns an diesem wolkigen Vormittag das erste Mal im Bannkreis der Humboldt-Universität. Ein Risiko, das ein Verhalten inkognito erfordert. Wir setzen uns in einen Vorraum des Gorki-Theaters, nachdem Joseph noch eine Zigarette wie McConaughey erledigt hat. Er erscheint uns blass. Wir sind nervös. Seine Strenge, die, weil sie sich so phantastisch ausspielt, selten sichtbar wird, erstickt jedes Gerede. Und reicht noch in das verschriftlichte Gespräch. Denn das, was zwischen dem Folgenden an vermeintlicher Geschwätzigkeit zu finden gewesen wäre, hat Joseph mit priesterlicher Sorgfalt vorab radiert.
Sein hypermobiles Denken, die ihm eigentümliche Gabe, die Dinge über ihre Heimatregionen hinauszustrecken, ist von der ersten Reaktion an unverwechselbar präsent.
Wir haben unglaublich viele Fragen. Geht Dir das auch so?
Ja, aber ehrlich gesagt nicht an Menschen. Die Fragen, die ich habe, betreffen Texte. Ich habe immer den Eindruck, dass die besten Antworten, die man erhalten kann, nicht geradewegs aus lebenden Mündern kommen, sondern dass man diese Antworten selbst suchen muss. Mir scheint, dass die Fragen, die mich beschäftigen, voraussetzen, dass es keine probaten Antworten gibt, und dass wirkliche Antworten erst unter der Bedingung kommen, dass man sie umständlich sucht.
Wenn es keine Adressaten im klassischen Sinne gibt – sonst hätten wir gefragt, wem du deine Fragen stellst –, heißt das dann auch, dass dieser Adressat keinen Körper hat?
Schon einen Körper, aber unterschiedlicher Natur – also Papierkörper, Buchkörper, was auch immer. Das Interessante an Fragen insgesamt besteht für mich darin, dass sie zunächst einmal nicht mit Antworten kompensiert werden können. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die herausfordernde Konstellation für mich nicht diejenige ist, Antworten auf Fragen zu finden, sondern umgekehrt: Zu gegebenen Antworten die entsprechenden Probleme oder Fragen zu suchen. Insofern würde sich für mich das Verhältnis zumindest teilweise umkehren.
Du fragst nicht, um Antworten zu bekommen. Aber Du antwortest, um fragen zu können.
Das sind zwei Formen: Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die ich habe, beispielsweise was die Finanzökonomie, was bestimmte politische Fragen betrifft. Ich weiß aber, dass ich darauf von Gefragten nicht unbedingt eine Antwort bekomme, sondern dass die Antwort Recherche benötigt. Es sind Suchwege, Umwege; Fragen werden nicht durch Antworten kompensiert, sondern zunächst mal durch lange Wege. Diese langen Wege sind auch Lektürewege, beispielsweise. Erstens. Und zweitens, noch einmal: Meine eigene Tätigkeit würde ich darin erkennen wollen, dass ich selbst nicht immer Lösungen für Probleme oder Antworten auf Fragen suche, sondern umgekehrt zu bestehenden Antworten und Lösungen die entsprechenden Probleme zusammensuchen möchte. Mein Eindruck ist: Wir sind von sehr vielen Antworten umgeben und haben oft die dazugehörigen Probleme vergessen. Das wäre auch gleichzeitig eine bestimmte Form der geisteswissenschaftlichen Arbeit.
Ein Denken in Umwegen. Das klingt nach Gilles Deleuze. Nach der Idee eines rhizomatischen Denkens, eines Denkens in Bahnen, derer wir uns nicht sicher sind.
Auf der einen Seite ist das völlig richtig. Es gibt also bei diesen Wegen das Glück – aber womöglich auch das Pech – des Unvorhersehbaren. Es öffnet sich ein Horizont von Ungewissheiten. Auf der anderen Seite – und das ist vielleicht auch deleuzianisch gedacht – ist eine solche Form der Denktätigkeit im elementaren Sinne problematisierend.
Man kann wohl zwei Wissenschaftstypen unterscheiden: Ein Großteil von Wissenschaften – dazu gehören Technik, Technologie, Ingenieurswissenschaften, auch manche Naturwissenschaften, auch die Medizin – müssen zwangsläufig Antworten für Probleme suchen. Das geht nicht anders, nur so kommt man voran. Und es gibt einen anderen Wissenschaftstypus, der eben zu bestehenden Lösungen oder Antworten die entsprechenden – und zwar verstellten, nicht mehr sichtbaren – Probleme entdeckt. Ich denke, dass etwa der historische Materialismus ein Beispiel dafür wäre. Das heißt, die Analysen müssen zu bestehenden sozialen »Lösungen«, wie dem Warenverkehr, Warenfetisch, Tauschwert etc., die entsprechenden Probleme finden. Die liegen nicht auf der Hand, sondern müssen eruiert werden.
Es gibt auf diesem Feld vielleicht noch eine zweite Unterscheidung, die ebenfalls das Verhältnis von Frage und Antwort betrifft. Die Unterscheidung stammt von einem Neu-Kantianer des 19. Jahrhunderts, Wilhelm Windelband. Windelband unterscheidet zwei Wissenschaften bzw. Wissenschaftstypen. Nämlich auf der einen Seite nomothetische Wissenschaften, deren Vorgehen darin besteht, Einzelfälle unter Gesetzmäßigkeiten zu subsumieren. Und ideografische Wissensformen oder Wissenschaften, in denen es darum geht, die Unverwechselbarkeit von Singularitäten darzustellen. Das heißt, hier gerät man nicht zu einer möglichen Gesetzmäßigkeit, sondern hier gerät man am Einzelfall vom Hundertsten ins Tausendste.
Wir sprechen über verschiedene Organisationsformen des Wissens, die entweder von den Antworten zu Fragen gelangen oder anders herum.
Ich würde das eher Denkethologie nennen. Also Verhaltenslehren des Denkens. Das kann über die Disziplinen hinweg unterschieden werden. Denken wir auch an so eine Unterscheidung, die Deleuze und Guattari gemacht haben: nomadische Wissenschaften und deterministische Wissenschaften. Ich würde mich jetzt vor dem Hintergrund Ihrer Fragen auf die Seite schlagen von Wissenschaften, die ideografisch, das heißt am Einzelfall orientiert sind, die eher nomadisch als deterministisch organisiert sind und die sich eben auch als eine bestimme Form der Problematisierungsweise verstehen.
Eine Sache wird umso unübersichtlicher, je genauer man sie ansieht.
Du sagtest anfangs, Du stelltest keine Fragen an Menschen. Aber vielleicht stellst Du ja Fragen mit Menschen? In deinen ikonischen Gesprächen mit Alexander Kluge gibt es Formen des Fragens, denen ihr nachgeht, die in dieser ideografischen Tradition stehen.
Das eigentümliche Katz-und-Maus-Spiel, das Kluge betreibt – man könnte auch sagen, es ist ein Spiel von Hase und Igel, wo ich mir immer wie der Hase vorkomme, während Kluge schon da steht und sagt: »Ich bin schon wieder hier« –; dieses eigentümliche Spiel, das eben auch etwas von einer gewissen Hetze an sich hat – man wird von Kluge gehetzt –, besteht eigentlich darin – und das ist das Überraschende dabei –, dass man selbst zu Antworten provoziert wird, die man noch nicht wusste. Das ist eine überraschende Angelegenheit. Es geht also nicht nur um Probleme, die man bisher noch nicht gesehen hat, und Fragen, die man noch nicht gehört hat, sondern man wird zu Fragen wie zu Antworten provoziert, die einem vorher noch nicht klar waren.
In irgendeiner Falte des Denkens bahnt sich also eine Antwort an, von der ich nicht sagen würde, sie lag bereits konfektioniert parat. Das ist, glaube ich, eine der Strategien von Kluge, Leute zu Antworten zu provozieren, die sie vorher noch nicht gelernt haben.
Und das ist vielleicht das Signum eines jeden guten Gesprächs: Dass man nicht Inhalte abruft, die schon verfügbar sind, sondern gemeinsam Inhalte herstellt, von denen man nicht wusste, dass man zu ihnen in der Lage ist.
Ja. Ich denke, es gibt da eine doppelte Stoßrichtung. Die eine zielt darauf ab, das Verhältnis von Frage und Antwort nicht wie einen Fragebogen zu gestalten. Das heißt, jetzt auch mit Deleuze gesprochen: Es gibt sehr viele Fragen, in denen die Antwort als Abklatsch der Frage bereits vorgesehen ist. Die Meinungsumfrage wäre so etwas. Da werden Dinge abgefragt, die durch die Frage schon vorgefertigt sind. In den Fällen, die für mich interessant sind, geht es darum, Antworten zu provozieren, die einen anderen Ereignischarakter haben. Zum Beispiel, dass im Zusammentreffen von Frage und Antwort die Dinge eher fremd als vertraut erscheinen; oder dass eine Antwort unterschiedliche Formen haben kann – beispielsweise kann auch eine Anekdote eine Antwort sein. Hans Blumenberg hat das einmal »Nachdenklichkeit« genannt. Es wird eine Antwort gegeben, die aber selbst irgendwo etwas an sich hat, mit dem man reflektierend noch nicht zu Ende kommt.
Eine Antwort muss nicht unbedingt ein Endpunkt sein: Jetzt und ein für alle Mal. Eine Antwort kann durchaus auch die nächste Frage provozieren. Diese Form von Offenheit – und das meintet Ihr ja auch mit dem Gespräch – wäre wohl mit dem Verweis auf Alexander Kluge aufgerufen. Erstens: Die Antwort ist nicht immer vorhersehbar; sie ist kein Spiegelbild einer Frage. Und zweitens: Eine Antwort kann in unterschiedlichen Genres formuliert werden und kann als Antwort selbst nochmal eine Frage mittransportieren.
Das heißt dann aber auch, dass die Form von Wissenschaft oder Theorie, die Du betreibst, permanent durch Erkundungsgänge verläuft und damit explorativ ist. Wenn Du keine Fragen vorwegnehmen kannst, sondern Antworten hast und dafür die Gegenstücke suchst – dann ist das eine andere Art Wissenschaft zu betreiben, als wir sie gelernt haben.
Das war eine ideale oder idealistische Beschreibung. Es funktioniert natürlich nicht immer so. Das heißt also, in Seminaren muss man auch schlüssige Antworten geben können. Das beruhigt und verhindert Studienabbrüche. Es ist also weniger ein bestimmter Wissenschaftstypus, als mit einem Genre von Wissenschaft oder Disziplin verbunden, als eine Denkbewegung innerhalb spezifischer Wissenschaften. Deswegen sagte ich Ethologie, also Verhaltenslehre des Denkens, und würde selbst so weit gehen, dass auch im Seminarbetrieb beispielsweise die produktivsten Angelegenheiten – und da ist, glaube ich, die Literatur ein ganz wesentlicher didaktischer Faktor –, dann nicht allein darin bestehen, Antworten von Texten zu bekommen oder die Texte mit Antworten zu überziehen, sondern Texte selbst als Interpretationen, d.h. als Auflösung versteckter Probleme zu begreifen.
Die erste Aufgabe der Universität ist, Komplexität zu lehren.
Sagen wir mal so: Komplexität in den bestehenden Dingen zu erkennen. Je genauer man eine Sache ansieht, desto unübersichtlicher wird sie. Ich denke, das ist eine genuin literarische Tätigkeit. Robert Musil hat das etwa am Fall Moosbrugger, am Fall dieses Lustmörders im Mann ohne Eigenschaften vorgeführt. Da gibt es einerseits eine pedantische Genauigkeit: eine Tat, einen Mord, dann ein Gesetz, dann das Urteil. Demgegenüber die phantastische Genauigkeit – man gerät von der Tat zu den Motiven, dann zu den Seitenmotiven und Umständen usw. Das Urteil wird aufgeschoben, die Urteilskraft versagt. Man sollte also Antworten auf der einen Seite und Urteile auf der anderen Seite auseinanderhalten. Sehr schnell sind mit Antworten bestimmte Urteile verbunden. Denken Sie wieder an Meinungsumfragen: Alles Urteile. Meinungen sind Urteile über Welt. Wie es bei der BILD-Zeitung heißt: Bild Dir Deine Meinung. Wir sind von diesem Meinungslärm, von diesem Urteilsfuror umgeben. »Mag ich, mag ich nicht.«
Gute Antworten sind, glaube ich, zunächst einmal die, die sich von der Urteilsförmigkeit befreien.
Von der Urteilsförmigkeit befreien. Und auch von diesem vorab unterstellten Ergebnischarakter.
Natürlich. Ich glaube, dass es sich lohnt, für das Verhältnis von Frage und Antwort die Distanzen zu ermessen, die dazwischen liegen. In diesem Dazwischen muss gearbeitet werden, in welcher Form auch immer: im Nervensystem, im Laufen, in Bibliotheksregalen, weiß Gott was. Samuel Beckett wurde einmal gefragt, ob es ›inexpressive‹ Kunst gäbe und antwortete zwei Wochen später: »Ja«.
Und das Unterscheidungsvermögen von urteilenden Meinungen und Tatsachen erwirbt man durch die Literatur?
Ich würde nicht die Unterscheidung zwischen Meinung und Tatsache machen, denn Tatsachen können schnell ins Meinungsförmige kippen. Meinungen lieben sogenannte Tatsachen. Denn diese sind meist kurz und brauchen nicht weiter begründet werden. Der Fetisch der Fakten hat die Rede von Fake News überhaupt erst möglich gemacht. Ich glaube nicht, dass Wissen ganz einfach Tatsachenwissen ist. Das wäre allzu simpel. Und was man von Literatur lernen kann: dass die Dinge, die Gegebenheiten, die Realitäten nicht unverrückbar sind. »Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben«, heißt es einmal bei Musil. Das wird von der Literatur auf die eine oder andere Weise beansprucht.
Auf den poststrukturalistisch gepflasterten Wegen, denen Du nachgehst und die Du aufzeigst, kommst du schnell in Abwegigkeiten. Dennoch aber gibt es eine objektive Härte der Institutionen, denen du unterstellt bist und die das immer wieder einzuengen, zu begrenzen, zu funktionalisieren suchen. Wie würdest Du dieses Verhältnis in Deiner Arbeit beschreiben?
Ich weiß bis heute nicht, was ›poststrukturalistisch‹ meint und wer ein ›Poststrukturalist‹ wäre. Solche Vokabeln werden meist nur zur Denunziation benutzt. Aber was den Widerstand der Institution betrifft: Damit kann man durchaus produktiv umgehen. Zum Beispiel so, dass man gerade in so unübersichtlichen Gebieten wie den Geisteswissenschaften nach pädagogisch wirksamen Verengungen, Systematisierungen, Kanonisierungen sucht. Man wird nicht davon dispensiert, dieses Fach und seine Gegenstände immer neu zu sortieren, vielleicht sogar zu erfinden. Es machte großes Vergnügen, als wir damals in den neunziger Jahren und an der Bauhaus-Universität Weimar das Studienfach »Medienkultur« erfanden und damit zusammen z.B. einen theoretischen Kanon, den es noch nicht gab und der dann von Benjamin bis Luhmann, von Adorno bis Deleuze, von Heidegger bis McLuhan reichte.
Du hast in München, in der Schellingstraße, studiert und dort eine germanistische Generation erfahren, die uns gar nicht mehr bekannt ist. Du hast damals auch Musil lieben gelernt. In welchem intellektuellen Klima bist Du dort großgeworden?
Also ich würde zunächst einmal sagen: kein besonders auffälliges. Ich habe erst im Nachhinein bemerkt, dass zur selben Zeit in anderen Städten, an anderen Universitäten tatsächlich intellektuelle Zentren entstanden waren, akademische Attraktionsorte. Das waren Freiburg oder die FU in Berlin in den 80er Jahren. Das war für mich aber, herkommend aus Niederbayern, jenseits des Horizonts.
Es sind eigentlich zwei Dinge, die mir passiert sind und die einen intellektuellen Effekt ausgelöst hatten. Das eine war die Begegnung mit Roger Willemsen und das andere die Beschäftigung mit Robert Musil. Roger saß damals an der Doktorarbeit über Robert Musil, methodisch eingerahmt von der Kritischen Theorie, insbesondere von Adorno. Vor diesem Hintergrund bin ich in die Lektüre des Mann ohne Eigenschaften geraten, und ich erinnere mich, wie das eine Woche andauerte – zurückgezogen, Stuhl in die Mitte des Zimmers gesetzt, nicht mit dem Lesen aufhören können. Sowas kannte ich noch nicht. Nicht diese Freundschaft und nicht diese Literatur. Und in den Gesprächen mit Roger bekam ich dann eine Ahnung darüber verpasst, was das heißen könnte, affektives Denken und intellektuelle Gefühle.
War eure Freundschaft ein Lesen mit vier Augen?
Nein. Unsere Freundschaft bestand in unendlichen Gesprächen, Flipperspielen, nächtlichen Streifzügen. Und aus wechselseitiger Ansteckung. Mich selbst hat das aus eher lauen Verhältnissen herausgerissen, ein Vitalitätsschub.
Was ist Freundschaft für Dich?
Das ist, glaube ich, eine … (zögert) Freundschaft ist die Entwicklung intensiver Treue unter der Bedingung, dass man sich zur Wachsamkeit zwingt. Also, Freundschaft, ich versuche es nochmal, wäre das Eintreten in eine mehr oder weniger bedingungslose Treuebeziehung unter der Bedingung, dass man intellektuell und emotional achtsam bleibt. Also dass es lebt, dass da nicht etwas einschläft, dass es nicht allzu vertraut wird.
Wenn man euch beide nebeneinanderstellen würde, Roger und Dich, dann würde man sagen, ihr wolltet einander nicht folgen. Während Roger entgegen den Lockungen der Postmoderne in die Literatur abgebogen ist, gingst du in die Theorie. Du bist ein Theoriebegeisterter, hast Dich begeistert für die Franzosen, die damals erstmals übersetzt oder auch im Original in Deutschland gelesen wurden. Die Literatur blieb dir dennoch wesentlich. Wie würdest Du in Deinen eigenen Schriften die Beziehung zwischen literarischer und theoriegeleiteter Erfahrung beschreiben?
Ich habe ein Problem mit dem Begriff des Theoretischen (und wieder mit dem der Postmoderne, der »Franzosen«), weil ich glaube, dass »Theorie« heute eine Hilfskonstruktion ist für bestimmte Formen der intellektuellen Tätigkeit. Wo würde ich den Unterschied …
… Du kannst anstatt »Theorie« auch einen anderen Begriff nehmen.
Ich habe es ja schon versucht: Verhaltenslehre des Denkens. Aber ich kann es noch platter sagen. Ich glaube nämlich, dass sehr viele Tätigkeiten, die man selbst ausübt, dadurch motiviert sind, die eigenen Defizite zu kompensieren. Und ich würde für mich selbst zwei solcher Defizite reklamieren. Das eine ist ein fehlendes Talent zum literarischen Schreiben. Was ich in dieser Richtung versucht habe, vor langer Zeit, hat mich nicht überzeugt. Also besser bleiben lassen. Das andere Defizit: ein schlechtes Gedächtnis. Das fühlt sich zuweilen wie eine Behinderung an. Wie kann jemand Literatur unterrichten, der ständig Romanschlüsse vergisst und nicht weiß, wie es ausgeht, und sie immer wieder neu lesen muss? Der Zitate vergisst und keine Gedichte auswendig kann? Der sich nicht ganz sicher an die Namen von Protagonisten oder Biographien von Autoren erinnert? Der muss sich den Dingen dann vorsichtig über Begriffe nähern. Oder Texte auf den Nenner einer Problemkonstellation, einer Denkoperation bringen. Daran kann ich mich dann erinnern. Solche Defizite führen also zwangsläufig zu anderen Fortbewegungsarten im Kopf, um sich die Sachen zurecht zu legen und den Überblick zu bewahren, vielleicht auch, um die Leute in irgendeiner Weise für eine Sache zu begeistern. Ich kann die Leute nicht mit Anekdoten unterhalten, weil ich – so oft ich sie lese und zu memorieren versuche – die Pointe vergesse.
Das erinnert mich an den Satz, der im Mann ohne Eigenschaften steht: Dass jede Schwäche, jede Not immer in eine Tugend umgewertet werden muss. So beschreibst Du vom Defizit aus die Qualität Deines Denkens.
Ich versuche es jedenfalls. Genauso wie jemand, der nicht hört oder schlecht hört, plötzlich einen schärferen Sehsinn hat oder mehr Aufmerksamkeit darauflegt. Ich denke, ohne einen Blick für die eigene Behinderung, ohne einen Blick dafür, dass man in manchen Dingen schlichtweg ein Freak ist, entwickelt man auch keine produktiven Seiten. Ich erinnere mich, ich denke, das war ein geflügeltes Wort zwischen Roger Willemsen und mir, an diesen Satz von André Gide: Einem Buckligen fehlt nichts. Ein Buckliger ist ein Mensch plus Buckel. Jede Behinderung ist auf eigentümliche Weise auch eine Gabe.
Ihr hattet beide eine große Sensorik für das, was man als das abfallende Leben beschreiben könnte. Foucault schrieb über das Anormale. Ihr habt dafür beide eine große Sensorik aufgebaut. Von den vermeintlichen Defiziten aus zu denken ist aber auch sehr anstrengend, oder?
Ja, das geht natürlich nicht ohne Enttäuschungen. Zunächst ist das eine Maschine zur Traumvernichtung. Die Maschine beginnt richtig zu arbeiten, wenn man ungefähr sechzehn Jahre alt ist. Da werden noch Knabenträume, Adoleszententräume eingespeist. Wenn man diese Maschine mit einigermaßen hoher Leistung betreibt, dann sind diese Träume mit Ende Zwanzig vernichtet. Zu dieser Zeit gibt es also so eine Art Erntedankfest, an dessen Schluss geschredderte Träume übrigbleiben (lacht). Ich glaube, durch solche Enttäuschungen muss man durch, oder auch gewisse Verfahren entwickeln, Restträume oder Traumreste so zu retten, dass man sie nicht mehr testet: Es gibt vielleicht die Chance, vielleicht würde ich diese oder jene große Sache noch verwirklichen – aber erst nach meinem Leben.
Seminare müssen auch der Fabrikation von Enttäuschungen dienen?
Seminare? Nein, keinesfalls. Eher Überraschungen. Die besten Seminare enden mit einer kleinen Überraschung am Schluss. – Aber ich meine wirklich Traumvernichtung, Traumverzicht, die Abwicklung narzisstischer Hoffnungen. Und Horchen auf die wenigen Talente, die dann noch übrigbleiben.
So wie man umfänglich einen Roman vorbereiten kann, den man nie schreiben wird, und zum Beispiel Seminare gibt zur Vorbereitung eines Romans, kann man wahrscheinlich auch sagen: Ich bereite das vor, was ich ohnehin eigentlich nicht vorhabe, aber die Vorbereitung selbst, die könnte wichtig werden.
Ja, aber ich würde es vielleicht noch etwas anders formulieren. Ich glaube, dass ein Großteil der produktiven Tätigkeit – und da würde ich nicht unterscheiden, in welchem Bereich die exekutiert wird – darin besteht, irgendwann vorsichtig zu bemerken, dass die überraschendsten Dinge, vielleicht auch die Dinge mit der größten Befriedigung für einen selbst, nicht von dort kommen, wo der Fokus der eigenen Aufmerksamkeit liegt, sondern oft von der Seite. Man will unbedingt einen Roman schreiben, und plötzlich erweist sich das Nachdenken über die Vorbereitung des Romans als produktiver als die Niederschrift eines Romans. Oder man plant seit Jahren, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten und verfolgt es auch ganz konsequent und merkt plötzlich, dass nebenan etwas herangewachsen ist, was zunächst als Beiläufigkeit erscheint, dann zur Hauptsache anschwillt. Es gibt also, glaube ich, eine große Produktivitätsrate in der intellektuellen Nebentätigkeit.
Hattest du solche Erfahrungen?
Ja. Ich versuche seit Ende der 90er Jahre eine größere Sache zu schreiben zu einem ganz bestimmten Thema, lese und exzerpiere, begleitet von der Anstrengung, immer wieder falsche Thesen zu korrigieren – und es gelingt einfach nicht. Stattdessen habe ich dann zwei Bücher über Finanzökonomie geschrieben. Das war nicht wirklich vorhersehbar.
Es gibt diesen Satz von Roland Barthes: »Ich bin mehr in die Idee verliebt, einen Roman zu schreiben, als in die Wirklichkeit, ihn geschrieben zu haben.« Gibt es ein ideales Denken, das nicht auf seine Verwirklichung schielt, der Du anhängst?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich aus einem Grund nicht sagen. Der Gedanke gefällt mir natürlich: das Denken selbst als Bewohnung, als Einwohnerschaft im Möglichkeitssinn zu begreifen und sich im potentialis aufhalten oder im Hypothetischen. Das, glaube ich, ist aber nicht der Fall, denn man muss sich wohl eingestehen, dass einiges von dem, was man dann treiben will, mit elementaren Wiederständen, Aufregungen, Ärgernissen zu tun hat. Ich würde nicht über Finanzökonomie schreiben, wenn ich nicht wirklich von der Sache bedrängt wäre. Dabei gibt es durchaus die kleine Hoffnung, etwas mehr zu tun, als bloß eine Frage zu stellen, und tatsächlich zu intervenieren.
Haben Dich auf deinem Weg nach Paris Widerstände und Ärgernisse auch schon begleitet?
Eher Fluchtbewegungen. Ich glaube, das waren eher Fluchtbewegungen, Unzufriedenheit in verschiedener Hinsicht. Die Sache war schlichtweg (zögert) – ich glaube, so muss ich das wohl sagen – biographisch wie intellektuell nach Orten zu suchen, die etwas weniger nach Heimat riechen, in denen eine erfreulich fremde Luft herrscht, oder so.
Was ist in Paris geschehen?
Eigentlich nichts Spektakuläres. Abgesehen davon, dass ich wie viele andere in den Vorlesungen von Foucault, in den Seminaren von Deleuze saß, und sonst eigentlich recht einsam war. Ich lebte in einer chambre de bonne ohne Klo und ohne warmes Wasser und im Winter auch ohne Heizung. Da gab es Einsamkeitsschübe, aber trotzdem hatte ich da im Grunde nichts, überhaupt nichts bereut. Es war eher überraschend, dass es funktionierte – dass es so funktionierte, dass man sagen könnte: eine gute Zeit. Was ich gesucht habe, war wohl tatsächlich so etwas wie verminderte Autochthonie.
Ist das die gleiche Motivation, die Dich analog zu Paris heute alle drei Jahre nach Princeton treibt?
Nein, das geht anders. Es beruhigt, nicht in den selben Räumen mit den selben Bücherwänden und den selben Aussichten zu altern. Es ist ganz gut, zwei verschiedene Fluchtlinien ins Grab zu haben – eine hier und eine dort (lacht).
Du bist dort »Permanent Visiting Professor«. Dieser Begriff ist insofern interessant, als dass er eine Aporie darstellt: ein dauerhafter Besucher ist ja kein Besucher mehr.
Ja, insofern gefällt mir der Begriff sehr gut.
Ist das auch eine Beschreibung deiner eigenen Biografie?
Ja, in einer gewissen Weise. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber da Du das erwähnst, wäre das, glaube ich, keine schlechte Beschreibung. Der Zustand des dauerhaften Besuchers ist nicht übel.
Für Derrida kann man Gast und Gastgeber zugleich sein.
Es sind auch ganz elementare, triviale, praktische Angelegenheiten. Änderung der Lebensweise, Kleinstadt statt Großstadt, weniger Betrieb, mehr Lektüren, vielleicht schreiben. Man muss das also gar nicht zu sehr theoretisieren. Es ist einfach eine Lockerungsübung, auch eine intellektuelle, wenn Lockerung unter anderem darin besteht, chamäleonhaft zu reagieren. Also in einem anderen Kontext, in einer anderen Lebenswelt funktionstüchtig zu bleiben.
Als ich vorhin nach der Härte der Institutionen fragte, hast du fast sanft über deinen bürokratischen und begutachtenden Alltag gesprochen. Du hast mal geschrieben, dass Du 50 bis 60 Prozent deiner Zeit mit derlei Dingen beschäftigt bist. Wie löst das Deine Arbeit auf, oder wie löst sich Deine Arbeit darin auf?
Da müsste ich mehr Sachen dazu sagen. Ich denke, dass eine Institution umgekehrt auch sowas wie einen Schutz darstellt, d.h. Wirklichkeit filtert, Lebensformen produziert. Ich würde die Institution samt Bürokratie nicht ausschließlich als das, was bei Max Weber das stahlharte Gehäuse heißt, wahrnehmen wollen. Ich denke, man kann die Institution auch umgekehrt begreifen: Manchmal sind es wirklich Schutzdächer. Manchmal kann man sich in der Institution unterstellen, wenn es stürmt. Was jetzt gegenwärtig besonders problematisch ist, sind die Monstren, die durch Deinstitutionalisierung entstehen. Das heißt also beispielsweise – und das ist überall spürbar – die Einführung von Marktprinzipien an der Universität, die Verschärfung von Konkurrenzkonstellationen, die Erzeugung von Wettbewerbslärm mit geringsten Mitteln. Bei gleichbleibend geringen Mitteln sollen mehr Verteilungskämpfe angeregt werden, um das Gehalt, um frei verfügbare Zeit, um Drittmittel, um Personal, etc. Daraus ist ein institutionelles Hybridwesen entstanden, in dem alte kameralistische Institutionen sich mit liberalen, marktwirtschaftlichen Einfällen kombinieren. Und diese Institution ist in gewisser Weise vampirisch geworden. Der einzige Vorzug: Die Universität ist kein abgeschiedener Ort mehr. Sie ist löchrig, und die kalte Zugluft aus der Restwelt bläst herein.
Die Intuition eines Außenstehenden wäre da doch, dass Du, wo Du doch durch deine Denkhaltung auf besondere Weise bedroht bist, diese Institution verlassen solltest. Warum hast du das nicht längst getan?
Das ist eine gute Frage und ich weiß darauf keine gute Antwort. Außer dieser: die Universität dispensiert einen immer noch weitgehend davon, Geschäfte machen zu müssen. Das ist kein Nachteil.
Vor zwei Jahren habe ich mit jemandem gesprochen, der drauf und dran war, seine Universitätskarriere entgegen aller Errungenschaften zu beenden. Er meinte dann, dein Einspruch habe ihn mit aufgehalten. Du scheinst in Momenten gar ein Anwalt dieser Institution zu sein.
Wahrscheinlich war mein Rat ganz und gar pragmatisch gemeint. Und das war, glaube ich, nicht falsch.
Jede Entscheidung sollte die Optionen erhöhen.
Gehen wir zurück nach Paris. Die Wegbewegung aus Deutschland war durchaus mit Widerstand und Ärgernissen verbunden, aber auch mit sehr vielen Hoffnungen.
Das ist jetzt sehr biografisch und daher wahrscheinlich nicht sehr interessant. Ich erinnere mich an Wintertage in Paris, an denen ich krank war und nicht aufstehen konnte und der Atem im Zimmer stand – und ich wusste: es wird niemand kommen, es wird niemand klopfen. Liegen bleiben und warten, bis das Fieber vergeht, wie drei Tage. Zwischendurch hört man Schritte aus dem Treppenhaus im sechsten Stock, wo die chambres des bonnes sind, und man wünscht sich, dass sie sich nähern, aber sie waren schnell verhallt. Wahrscheinlich waren es solche Erfahrungen, die mich nach meiner Rückkehr veranlassten, eine Freundin dazu zu überreden, mit mir zusammenzuziehen. Das ging dann sehr schnell schief.
Warum glaubst Du, dass das nicht interessant ist?
Weil sich das wie eine kleine Geschichte anhört und weil sie wahrscheinlich auch gar nicht so stimmt.
Das überzeugt mich nicht.
Nein?
Du hättest ja auch sagen können, du willst dein Werk vor dich stellen. Weil Du glauben magst, Du selbst, Joseph Vogl, seiest nicht ebenso wichtig wie der Text.
Ja, sehr gut gesagt. – Aber das mit dem Werk und dem Zurückstellen der eigenen Person – ich habe eben jetzt keine Lust, solche abgeschmackten oder koketten Dinge zu sagen. Und wenn ich Misstrauen bei biografischen Fragen hege, so liegt das daran, dass man das eigene Leben dann sofort nach herausragenden Momenten, großen Umschwüngen, entscheidenden Begegnungen, tiefgreifenden Erfahrungen absucht – und oft nur wenig dergleichen findet. Oder vielleicht Peinlichkeiten oder Unfälle. Ein Beispiel, biografisch. Meine Begegnung mit Gilles Deleuze in Paris halte ich immer noch für eine entscheidende. Ich saß in seinem Seminar, aufgeregt und voller Bewunderung, hatte die tollsten Einfälle dabei. Und ich musste sie unbedingt veredeln, das Gespräch mit Deleuze suchen. Ich raffte also allen Mut samt Französisch zusammen, in einer Pause, und da sich im Seminar alle duzten (es war ja eine linke Reformuniversität), fing ich ungefähr so an: »Gilles, ich hab da eine Idee, ein Thema, ich würde gerne über Phänomenologie, Antipsychologie und Expressionismus arbeiten, etc.« Ich war ja jeden zweiten Abend im Kino, das Seminar handelte vom expressionistischen Film, und gerade war Bergson dran. Aber Deleuze trat bloß drei Schritte zurück, schaute mich an und sagte: »Monsieur, Monsieur, das ist ein sehr interessantes Thema. Wir könnten zehn Stunden darüber reden. Also lassen wir es besser.« Das war meine erste Begegnung mit Deleuze; oder so ähnlich (lacht). Die wirkliche Begegnung habe ich dann später nachgeholt, mit Übersetzungen seiner Bücher. Das war dann mein eigener, selbst gebastelter Gilles Deleuze, und der konnte sich nicht wehren.
Ist das ein Gehen entgegen dem geringsten Widerstand?
Nein. Ich habe nur gelernt, dass es einen Unterschied macht, ob man Namen und Personen oder intellektuelle Ressourcen sammelt. Und dass man seine Autoritäten, wenn sie noch leben, nur behelligen sollte, wenn man mit echten Fragen auf echte Antworten hoffen kann.
Wie verfährst Du mit Deinen Doktoranden?
Nach deren Begehr.
Wenn sie wollen, liest du jedes Kapitel?
Ja.
Mit deiner Doktorarbeit ist es gut gegangen, mit der Habilitation, einem ähnlich riskanten Projekt, ist es auch gut gegangen. Danach bist Du nach Weimar gekommen. In diesen riskanten Momenten, in denen man so fragil in seinem Pariser Altbau sitzt, allein, erscheint manches unwahrscheinlich und könnte immer schiefgehen. Aus der heutigen Perspektive aber scheint es, als wäre alles sehr, sehr gut gegangen. Hast Du das Gefühl, dass Du Dir immer wieder ein Glück vorzeigen musstest? Dass Du Dir dieses Glück nicht ausreden lässt?
Darüber denke ich nicht nach. Ich sitze nicht wie Robinson auf seiner Insel und rechne Soll und Haben gegeneinander auf. Wenn ich es täte, würde ich im Rückblick auf diesen oder jenen Augenblick wahrscheinlich sagen müssen: Glück gehabt. Und feststellen, dass man wohl mit einer großen Menge an Zufällen, mit ein paar unklaren Absichten und sehr wenig Vorsätzen durchs Leben gesteuert ist. Und wenn ich immer wieder etwas in Erinnerung rufen muss, dann wäre das vor allem Dankbarkeit darüber, dass mir in kritischen Momenten geholfen wurde.
Als Du in Paris warst, war Roger Willemsen in Italien. Dann habt ihr in München zusammengewohnt, schließlich ging er nach London und Du nach Berlin. Rogers Briefe an Dich wurden teils veröffentlicht; er jammerte ein wenig. Wie sahen deine Briefe aus?
Ich glaube, sie waren wohl recht elaboriert. Und standen im Bann von Roger Willemsens eigener Schreiblust, einer großen Kunst, sich im Schreiben gleichzeitig an andere und an sich selbst zu adressieren. Er konnte eine schriftliche Existenz führen, mit dem Notizbuch durch die Tage und auf Reisen gehen, Beobachtungen, Begegnungen, Dialoge sammeln. Für mich dagegen ist Schreiben stets eine Quälerei, Qual für den Rücken, Mühe bei der Suche nach Worten, Unzufriedenheit mit Sätzen und Formulierungen.
Dein Denken ist ereignishaft und auch begrifflich. Der Begriff neigt sich zum System wie sich das Ereignis zum Literarischen neigt. Da muss es doch in der Mitte eine Reibung geben?
Ich hatte vorher ja klarzumachen versucht, dass ich gerade keine Reibung oder Spannung zwischen Ereignis und Begriff sehe. Aber vielleicht ist auch etwas anderes gemeint, etwas Habituelles, das Navigieren in Lebenslagen. Und da wurden sicher Divergenzen bemerkbar, vielleicht sogar produktive, vielleicht sogar Ergänzungen. Was etwa Roger Willemsen und mich angeht (und darauf bezieht sich ja die Frage?), so war eines sehr schnell klar: Er war ein guter Reisender, ich bin ein miserabler Reisender. Ein guter Reisender ist einer, der erstens keine Risiken scheut, zweitens einen genauen Blick fürs Fremde und Andere hat und drittens – wie soll ich das formulieren – auch mit einer gewissen Obdachlosigkeit umgehen kann. Ich bin erstens nicht besonders kühn oder mutig, muss zweitens auf das Bedeutende und Ungewöhnliche hingewiesen werden und vermisse drittens sehr schnell manche Bequemlichkeiten.
Das heißt, ein literarisch Schreibender ist ein Reisender schon auch der Tätigkeit nach, und jemand, der schreibt wie Du, ist einer, der Routen legt und die dann abgeht?
Besser und anders gesagt: Für den Reisenden gehört, glaube ich, auch eine bestimmte Form der Erwartungsfreude dazu, und die ist nicht ohne Optimismus zu erhalten. Die verminderte Reiselust ist mit einem leicht düsteren Blick verbunden: Ich werde eh überall dasselbe sehen – mir wird in der Ferne McDonald's entgegenkommen, warum muss ich das dort erleben? Ich würde das so formulieren: Reisen und gutes Reisen heißt Erwartungsfreude, und bei mir würde ich von Erwartungsunlust sprechen.
Vielleicht hängt das auch mit der Eingangsbeschreibung zusammen, die sich im Laufe des Gesprächs als sehr prominent erwiesen hat. Dass Du Fragen an Texte hast und nicht an Menschen. Wenn man Texte sehr eng fasst und, sagen wir mal, Bücher und Texte und das Textliche, also tatsächlich Schrift, meint, und »Menschen« eher zwischenmenschliche Erfahrung bedeutet, die man gerade beim Reisen mit einer ganz feinen Sensorik wahrzunehmen hat, weil das viele fremde Sprechweisen und Rituale und Lebensweisen sind – entdeckst du am Text etwas, das dich vertrauen lässt? Weil Du vielleicht auch stärker seine Reize kontrollieren kannst?
Ich leide sehr schnell an so etwas wie sozialer Erschöpfung. Ich muss das jetzt auch nicht mehr parallel führen zu Roger Willemsen, aber vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung dazu. Für ihn zählte der emphatische Moment, der epiphanische Moment, der Moment der Ansteckung und der Inspiration. Das reicht bis in die Schreibweise: Bei aller genauen, sezierenden Betrachtung blieb in seinen Texten stets eine Neugierde spürbar, die man wohl philanthropisch nennen muss. Ich habe mich eher aufs Schwarzmalen verlegt, reduzierte Menschfreundlichkeit. Vielleicht bin ich so auch an die letzten Gegenstände gelangt, dysphorisch gestimmt, also an Dinge wie die Finanzmärkte.
Hast Du das Gefühl, dass Dir das mit der politischen Ökonomie oder dem Finanzsystem jetzt mit diesen letzten zwei Büchern gelungen ist?
Das weiß ich nicht. Aber für mich sind sie wenigstens durch die aufgewendete Anstrengung gerechtfertigt, durch die Anstrengung, vor dem, was unsere Gegenwart wie nichts anderes prägt, also vor dem aktuellen Finanzregime nicht vorschnell intellektuell zu kapitulieren. Nicht kapitulieren, ja, darum geht es mir.
Weil sich Joseph Vogl noch mit der Universitätspräsidentin treffen muss, verbringen wir die Mittagspause, die für ihn keine ist, getrennt. Als wir uns wieder vor dem Gorki-Theater treffen, setzen wir uns vor einen Bauzaun auf eine Bank ohne Lehne. Und dann passiert uns der stereotype Fehler, ein technischer Fehler. Plötzlich ist der zweite Gesprächsteil verloren. Wir sprechen über Auswege und ähnliche Unfälle.
Wir haben gerade eine halbe Stunde lang über Sicherheit und Unsicherheiten gesprochen. Und haben diese Aufnahme verloren. Meinst Du, es tut Gesprächen gut, wenn sie Dinge, die gesagt wurden, nicht mehr nach außen sichtbar machen können?
Also meine Erfahrung ist, dass ein verlorener Text eine produktive Gelegenheit sein kann. Mir sind diese Dinge passiert, unter anderem mit einer Übersetzung, Differenz und Wiederholung von Gilles Deleuze vor langer Zeit, wo ich einen Fehler gemacht habe und auch die Sicherheitskopien überschrieben habe mit einer kaputten Datei.
Du musst dazu sagen, wie viele Seiten Du verloren hast.
250 Seiten ungefähr, 200 bis 250 Seiten. In meiner Verzweiflung habe ich beim Landeskriminalamt angerufen, die hatten gerade gelöschte Dateien in einem Rauschgiftfall wiederherstellen können. Gelächter am anderen Telefon. Aber auch der Hinweis auf einen jungen Typen bei der Münchner Rück, Fehlerspezialist und Feuerlöscher. Der hat sich erbarmt, konnte an zwei Abenden ein Patchwork aus achtzig Seiten wieder sichtbar machen, nicht ohne Kopfschütteln über einen so seltsamen Text. Er wollte nicht bezahlt werden, ich konnte ihn nicht bezahlen, mit einem Jahresabonnement von AutoMotorSport habe ich mich dann bedankt, beidseitige Zufriedenheit. Fazit aber: die Übersetzung ist dadurch schlicht besser geworden – mit der vagen Erinnerung an den alten Text haben sich dessen Schwächen scharf gestellt.
Und so wie man einem Buch, indem man es neu schreibt, und einer Übersetzung, indem man sie neu schreibt, Qualitäten und Tiefe einschreibt, die sie vorher nicht hatten, so kann es mit Gesprächen ja auch sein. Wir haben gesprochen über die Sicherheit als ein Geschick, mit Unsicherheiten umzugehen. Und dass das etwas ist, was man in unserer Zeit, die man als eine Zeit des Umbruchs beschreibt, lernen muss. Jetzt sprechen wir aus eben diesem dunklen Raum heraus und können entscheiden, was wir daraus heben sollen. Es scheint, als würde dieses Gespräch just ein wenig aufklaren. Liegt etwas Hoffnungsvolles in dieser Vorstellung eines zweiten Versuchs?
Ich werde wohl beim Schwarzmalen bleiben, auch im zweiten Versuch, dazu bin ich talentiert. Aber ich würde nie behaupten, dass das mein Endurteil wäre. Glücklicherweise gibt es da Arbeitsteilung, Schwarz- und Buntmalerei, wie ich das in der Begegnung mit Alexander Kluge gelernt habe. Wo ich misanthropisch bin, ist er philanthropisch, wo ich misstrauisch bin, predigt er Vertrauen, wo ich erregt bin durch gegenwärtige politische Zumutungen, geht Kluge ins Pleistozän zurück.
Da gibt es also ein Unvernehmen zwischen Dir und uns. Wo wir noch die Hoffnung haben, zum Beispiel auf die Entstehung neuer Solidarmilieus, auf produktive Gemeinsamkeiten, auf deren politische Wirksamkeit, würdest Du zögerlich reagieren. Aber vielleicht gibt es eine verbindende Perspektive: Was historisch einmal möglich war, muss auch jetzt möglich bleiben.
Ja. Ich würde aber nur zu bedenken geben, dass es heute sehr starke Gegenkräfte gibt: Konkurrenz, Atomisierung überall und eine Lage, in der die Abneigung aller gegen alle zu einer Art neuem Gemeinschaftsgefühl geworden ist, wie Musil das einmal gesagt hat. Das spricht aber nicht gegen einen Optimismus, den man zwar nicht unbedingt fühlt, der aber praktisch eingebaut ist in Tätigkeiten. Das politische Intervenieren gehört dazu, nach Hannah Arendt ja ein Handeln-in-Gemeinschaft, zwangsläufig. Und wahrscheinlich gehört auch Lehren dazu. Das funktioniert ja nur mit der Unterstellung, dass es Gemeinsamkeit gibt, geben wird, über Generationen hinweg. Einen alterslosen Kern, vielleicht eine der besten Seiten der Universität.
Wenn Universitäten intergenerationell angelegt sind, dann gelingen sie doch auch nur dort, wo die Weitergabe von Wissen, seine Organisation und auch der Wissensanbau, funktioniert.
Ja, aber als reziproke Angelegenheit: Man legt die Neugierden zusammen, sucht gemeinsam nach frischer Luft. Im besten Fall kommt dann die Neugierigkeit der Jüngeren auf die Älteren zurück.
Man kann sich anstecken lassen, muss sie aber auch verwandeln.
Natürlich. Das wäre dann ein gewisses Gegenmittel gegen intellektuelle Schläfrigkeit. Ich würde sagen, über Generationen hinweg kann man sich am besten über die Bekämpfung von Schläfrigkeit verständigen.
Du hast gesagt, dass man in der Akademie auf einen alterslosen Kern stößt. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass man sich in diesen Regionen, wenn man noch keine innere Kündigung vollzogen hat, schlichtweg nicht darauf verlassen kann, dass man mit einem einmal und einstmals gesicherten intellektuellen Bestand sich einigermaßen grazil weiter fortbewegen kann. Die Dinge veralten einem oder altern einem in der Seele weg, sozusagen. Der Zwang, Texte zu lesen, an die man nie gedacht hätte, intellektuelle Osmosen, gegen die man sich nicht wehren kann, die Zumutungen an den Restehrgeiz, wenn einem ein unbekanntes Gedankending präsentiert wird. Da können kahle Seminarräume plötzlich möbliert werden durch intellektuelle Präsenz. Eine erfreuliche Angelegenheit.
Das Gespräch ist vorbei. Doch wir wollen ihn noch »IRL« zeigen. Es ist spät geworden, die Zeit entgleitet uns zusehends und dann setzt der Regen ein. Auf Wiedersehen, Joseph! Hoffentlich.
Ein knappes halbes Jahr später sehen wir uns in Frankfurt wieder. Er ist in Eile. »Wie geht es dir?« — »Müde.«
Wir sprachen mit Joseph Vogl am 27. Juni 2019 am Berliner Gorki-Theater. Wir haben das Gespräch fortgesetzt.
Produktion: Max Farr, Pia Amelung, Simon Böhm
Fotografien: Holm-Uwe Burgemann
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.