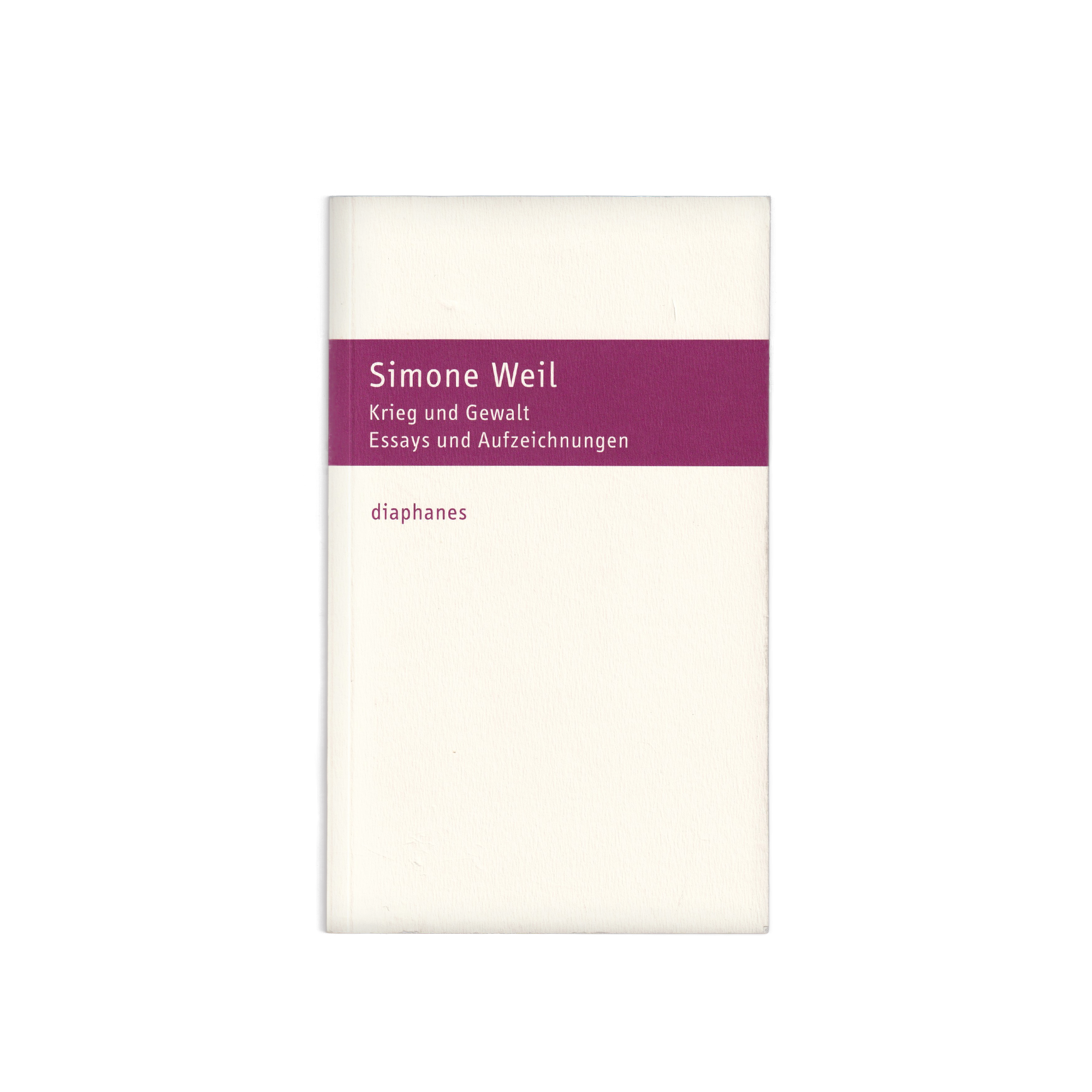#56 Simone Weil: Die Ilias oder das Poem der Gewalt
Sie war eine Monolithin am Abgrund. Eine Revolutionärin der Moderne selbst, geboren in einer Welt, die für sie keine Zeit zu sterben duldete. »Von dem Feuer, das Christus zur Erde warf und das vielleicht das des Prometheus war, sind einige glühende Kohlen in England geblieben. Wir sind verloren, wenn nicht aus diesen Kohlen und Funken, die auf dem Kontinent glimmen, eine Flamme hervorgeht, die Europa erleuchten kann. Vergessen wir nicht, dass Europa nicht von Horden unterjocht wurde, die von einem anderen Kontinent oder vom Mars kamen, und dass es nicht ausreichen würde, sie zu verjagen. Europa leidet an einer inneren Krankheit«, schreibt Simone Weil 1943 mit wahrhaftiger Dringlichkeit. Wenige Aufsätze aber sind von einer geschichtlichen Weitläufigkeit und analytischen Geschicklichkeit wie »Die Ilias oder das Poem der Gewalt«, den sie einige Jahre zuvor pseudonym veröffentlichte; längst inmitten eines Krieges, in dem sie fortan immer deutlicher einen Krieg der Religionen sah.
Ihr kurzer Aufsatz über Homers Ilias als die Urszene der modernen Gewalt könnte heute ikonisch sein – wäre er von den späteren und meist schmalspurigeren Schriften anderer nicht verdeckt worden. Die Erfahrung, einen Text von so schneidender Klarheit und so schlagender Imagination erst spät gelesen zu haben, ist universell. Sofern es denn dazu kommt. Während Susan Sontag und Judith Butler für die linke Theorie der Gegenwart kanonisch sind, steht Simone Weil für viele nur auf den niederen Rängen der Aktivistinnen und Augenzeuginnen. Ihre Gewaltanalyse aber beweist eine umstandslose Gegenwärtigkeit, die sie zur Stimmbildnerin der Linken befähigt, die sie dann doch nicht sein kann.
Womöglich, weil von ihr auch jene als Betroffene geführt werden, die andere zum Gegenstand der Gewalt machen. Und weil es dort, wo alle betroffen sind, keine Schuldigen mehr gibt. Und weil das die wenigsten aushalten.
Von dir habe ich die Vorstellung, dass die Philosophiegeschichte aus toten und lebendigen Pferden besteht. Simone Weil, sie ist ein lebendiges Pferd, nicht wahr?
Das stimmt sicher, wobei es eine generalisierende Antwort auf die Frage, was einen Autor lebendig macht, wahrscheinlich nicht gibt und auch nicht geben darf. Es gibt aber sicher Autoren, die in der Rezeption so weit ausdifferenziert sind, dass es schwer ist, aus ihnen noch Funken zu schlagen, sowohl für andere, als auch für sich selbst. Sie sind in einer problematischen Weise überschrieben oder ausgeschrieben. Bei Simone Weil ist das Gegenteil der Fall. Sie ist vielmehr unterschrieben. Man kann sogar sagen, dass sie eine der großen Vergessenen, die große Vergessene der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist, die von allen großen Rezeptionslinien des 20. Jahrhunderts nicht nur vergessen, sondern verdrängt wurde. Von mir selber kann ich nur beobachten, dass die Begegnung mit Simone Weil eines der wuchtigsten Lektüreerlebnisse der letzten 30 Jahre war, und dass ich nicht fassen konnte, noch immer nicht fassen kann, dass es so wenige Menschen gibt, die sie lesen. Dass sie so wenig in unserem Gespräch über uns selbst präsent ist.
Geschichten sind immer zirkumstanziell, sie liegen in ihren Umständen. Magst du beschreiben, wie du sie kennengelernt hast?
Gern. Man muss aber zuerst einmal erzählen, dass man in meiner Generation zwanzig Jahre lang durch ein Studium plus Promotion gehen konnte, ohne diesen Namen ein einziges Mal zu hören. Die erste wache Erinnerung ist, dass es da eine Frau gab, die sich zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu Tode hungerte. Das war, was man wusste. Und unterlag einem starken Pathologieverdacht.
Die Auseinandersetzung mit Simone Weil ist eine, die für mich erst vor drei Jahren begann. Die ersten Texte, die ich las, waren Texte wie »Stehen wir vor einer proletarischen Revolution?«, die eher politisch sind und aus den frühen Dreißigern stammen. Aber meine Erfahrung mit Simone Weil ist, und das trifft fast für alle großen Autor:innen zu, dass, wenn man ihnen nur drei Seiten gibt, man mit einer Sprache, mit einem Geist, und auch mit einer Person vertraut wird, die nicht nur singulär ist, sondern eine tiefe Kraft, eine Einsichtsstärke aufweist. Im Fall von Weil ist dies fast ohne Vergleich. Im 20. Jahrhundert lässt sie sich, wenn überhaupt, nur mit Wittgenstein vergleichen. Auf nahezu jeder Seite sticht ihre Fähigkeit heraus, auf ein Problem mit einer strahlenartigen Direktheit zuzugehen. Und von diesem Problem dann nicht abzulassen. Die Kompromisslosigkeit, die sie in ihrem Leben zeigt, zeigt auch ihr Denken. Das hat etwas Gnadenloses, fast Schmerzhaftes. Simone Weil zu lesen ist eine Erfahrung, die einen nicht schont – und die sie selbst auch nicht als schonend angelegt hat.
Wer diesen Text, über den wir sprechen wollen, »Die Ilias oder das Poem der Gewalt«, auf Deutsch lesen möchte, wird sich den Band Krieg und Gewalt des diaphanes Verlags besorgen müssen. Ein Buch, das zu aller Überraschung wirklich nur eine Textsammlung ist. Ohne jede Einführung.
Und ein Buch, dass dann auch ohne jede Resonanz geblieben ist. Der Verlag hat Großartiges geleistet in der Übersetzung dieser Texte. Es ist aber meiner Erkenntnis nach fast resonanzlos, auch am Feuilleton, vorbeigegangen – es fiel tot aus der Presse, als ob es nicht erschienen wäre. Aber du hast recht. Es gibt keine Einleitung. Das ist womöglich etwas Gutes, Schönes. Es hat damit zu tun, wie sie gelesen werden will. Sie ist ja eine Schülerin von Alain [Émile Chartier], der viel Wert darauf gelegt hat, Philosophen in direktem Kontakt zu begegnen, anstatt sich in der Lektüre orientierend an Sekundärliteratur oder Kommentare zu halten. Spricht der Text zu mir, wie spreche ich zu ihm – das Spiel des Denkens. Dieser Primärkontakt, dieser ungeschützte, ist, was sie als Autorin anstreben und als Leserin suchte. Man kann sich diesen Texten deshalb auch sofort, unmittelbar, nähern. Ihre Zugänglichkeit wie Dringlichkeit ist bis heute intakt. Durch alle Zeit und alle Konstellation sprechen sie zu einem. Dieses Vermögen gewinnen sie nicht durch Kontextualisierung, durch Einordnung. Es ist wohl eine Wahrheit, dass jede Begegnung mit der Philosophie nur eine Begegnung über die Geschichte der Philosophie selbst sein kann. Es gibt dabei auch Autor:innen, die so klar und direkt sprechen, dass sie es geradezu erfordern, sich nicht ablenken zu lassen, sondern nur auf sie selbst zu hören. Simone Weil ist so eine Autorin.
Welche sind die ersten Sätze, die dich nicht mehr losgelassen haben?
Sicher die Sätze zum Wesen der Gewalt. Die Arten und Weisen, wie Gewalt, im Original force (es kann also auch Macht oder Kraft bedeuten), Menschen bei lebendigem Leibe zum Ding werden lässt. Es handelt sich also um eine Theorie, oder besser, Phänomenologie der Verdinglichung, die indes nichts mit Theorien der Verdinglichung marxistischer Provenienz zu tun hat, sondern das Bewusstsein dafür wach hält, dass es Zustände gibt, in denen Menschen, obgleich sie noch leben, alles Menschliche verloren haben, und dass es Zustände gibt, in denen man im Zeichen der Macht blind für das Leid Anderer wird und blind für sich selbst als Leid-Zufügenden. Weils Blick für die Symmetrie, die in jeder Gewalterfahrung im Spiele ist, und die beide, den Ausübenden wie den Erleidenden, in gleicher Weise verdinglicht. Das ist vielleicht der zentrale Satz, der zentrale Impuls in diesem Text. Er lautet, und ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ungefähr: Die Gewalt lässt niemanden so, wie er ist, sie verändert immer beide. Die große Tiefe dieses Textes besteht ja gerade für heutige Zusammenhänge, in denen wir immer mehr auf die Opferperspektive achten und sie gleichsam verabsolutieren, darin, auch immer zu sehen, dass diejenigen, die Gewalt ausüben, ebenfalls Opfer dieser Dynamik sind und als Opfer dieser Dynamik kenntlich gemacht werden müssen.
»Die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. Wird sie bis zur letzten Konsequenz ausgeübt, macht sie den Menschen zum Ding im wortwörtlichsten Sinne, sie macht ihn zum Leichnam. Da war jemand, und mit einem Mal ist da niemand.«
Dieser erste Satz ist wahrscheinlich der entscheidende: Die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. Auf zwei Weisen macht sie ihn zum Ding. Was meint Weil damit?
Zunächst ist es interessant, dass sie mit dem Tod die sichtbarste und augenfälligste Form der Dingwerdung einsetzt. Sofern wir überhaupt noch Tote zu sehen bekommen und wir uns ihnen nähern dürfen, ist das Augenfälligste, dass da jemand war und nun niemand mehr ist. Das ist abgründig – und bis heute, wenn wir ehrlich sind, tief rätselhaft. Der Verstand erreicht diese Erfahrung nicht. Die Extremform bedeutet die Grenze. Aber diese Form der Dingwerdung ist für Weil in ihrer Durchdringung des Wesens der Gewalt nicht die bestimmende. Der zentrale Impuls, mit Blick auf diese Zeit, ist – wie Hannah Arendt annähernd zeitgleich formuliert – dass man zum lebendigen Leichnam werden kann, dass also die Verdinglichung die Lebendigen in gleicher Weise trifft. Sie meint, dass es Formen der Erniedrigung durch Andere gibt, die jede Form menschlicher Plastizität in diesen Erleidenden ersterben lassen, sie vor dem Tode als Menschen auslöscht. Dass man, wie sie sagt, »versteinert« – bei lebendigem Leibe. Das führt vom Tod zur Sklaverei zur kriegerischen Existenz zur Existenz in Zustände, die allgemein als »Kriegszustände« zu fassen sind. Und tatsächlich will sie in diesem Text, am Vorabend der Invasion der Deutschen Wehrmacht, freilegen, dass dieser Kriegszustand, der über allem schwebt, eine flächendeckende Verdinglichung aller Betroffenen bewirkt. Es droht der Eintritt in einen Zustand der Gnadenlosigkeit anderen und sich selbst gegenüber. Weils Frage lautet: Was bedeutet es für die Menschen eines Landes, das sich im Krieg mit anderen befindet? Was bedeutet es für alle, oder besser, jede/n einzelne/n – und nicht nur für diejenigen, die an der Front stehen.
Das mit dem Einmarsch, den sie als Einmarsch der Deutschen selbst mit ansehen musste, ist interessant. Denn im Text gibt es immer wieder Formulierungen, die eine Vorwegnahme der Verdinglichung beschreiben. Allgemein würden wir ja glauben, Verdinglichung geschieht erst mit der konkreten, sichtbaren Gewaltausübung. Wir stellen uns das sehr praktisch vor. Dagegen schreibt Weil:
»So agieren diese Waffenträger mit sinnloser Härte, ihre Waffe bohrt sich in einen wehrlosen Feind, der ihre Knie umfasst. Sie triumphieren über einen Sterbenden, indem sie ihm die Schändungen seines Körpers ausmalen.«
Der Stich, also die physische Gewaltsamkeit, ist mit der Gewalt als solcher nicht identisch.
In dem Moment, in dem das geschieht, ist die Schändung natürlich eine Selbstschändung. Es ist ein Text, der insgesamt von Symmetrien handelt. Von solchen der Gerechtigkeit und solchen des Zufalls. Das sind die beiden großen Momente im Text. Einerseits legt Weil frei, dass die zentrale Einsicht der Ilias als ethische Einsicht darin besteht, dass es eine Symmetrie der Gewalt gibt, die sich im kriegerischen Zusammenhang dadurch zeigt, dass sich niemand zu keinem Zeitpunkt sicher sein kann, ob er Opfer oder Anwender von Gewalt sein wird. Und dass die Frage, woran sich das entscheidet, eine ist, die sich menschlichem Handeln durch Kontingenz entzieht. So ist also die Kontingenz, die vor allem diejenigen trifft, die sich in absoluter Machtfülle wähnen. Eine, die für eine Symmetrie zuständig ist, der kein menschliches Wesen je entgehen kann. Das ist mit das Tiefste, was über das Wesen der Gewalt und des Krieges geschrieben wird – inwieweit die Kontingenz zu einer Symmetrie der Gewalterfahrung führt. Hierfür fordert sie eine Art antizipierende Gerechtigkeit ein. Du sagtest, einerseits nimmt sie vorweg, was der Krieg mit den im Krieg Befindlichen tut. Andererseits steckt darin natürlich auch die Möglichkeit, sich vor Augen zu führen, welche Haltung erforderlich wäre, um sich dieser scheinbar notwendigen Verdinglichung zu entziehen; eine Bewusstmachung der menschlichen Existenzsituation. Man liest Simone Weil richtig, wenn man sie als eine Existenzialistin in diesem Sinne sieht. Nicht eine der Selbstermächtigung und Ausnahmesituation, sondern eine Existentialistin der Gnade, die sich all dem ausgesetzt hat, sich dem stellt, es annimmt, und daraus ethische Schlüsse zieht, die nichts damit zu tun haben, dass wir uns als wollende Subjekte selbst entwerfen, sondern dass wir uns als passive Subjekte in dieser Geworfenheit anderen Menschen annehmen. Keine Situation macht dies schwieriger als die des Krieges, weil der Krieg der Zustand ist, in dem der Andere nur als Feind adressierbar ist – und in diesem Sinne eine Gewaltausübung auf beiden Seiten als notwendig erscheinen lässt.
»So vernichtet die Gewalt alle, die mit ihr in Berührung kommen. Am Ende wird sie zu einer äußeren Macht, ebenso für den, der sie ausübt wie für den, der sie erleidet; so entsteht die Idee eines Schicksals, vor dem Täter und Opfer gleichermaßen unschuldig sind. Sieger und Besiegte Brüder im gleichen Elend. Der Besiegte verursacht das Unglück des Siegers ganz genauso wie der Sieger das des Besiegten.«
Diese Symmetrie bedeutet, dass die Gewalt den Menschen immer äußerlich ist.
Ja, das wäre die zweite potentiell heilende Einsicht für all diejenigen, die glauben, Gewalt im Griff zu haben. Und solche gibt es zuhauf: Menschen, die in eminenten Machtpositionen sind. Sie glauben, sie hätten die Macht. Wo Macht doch etwas ist, was umgekehrt gerade uns im Griff hat. Und nur im Griff haben kann. Das ist die entscheidende Gedankenfigur. Blindheit ist ja ein durchgängiges Motiv im Text, weil derjenige, der Macht über andere verfügt, Blindheit für seine eigene Ausgesetztheit genauso wie für die Leiden der Ausgesetzten entwickelt. Von dieser Blindheit müssen wir uns befreien. Das ist ein Schritt, den Weil als den Schritt ins Licht, ins Licht der Gnade, versteht – dieses Licht, von dem sie immer wieder spricht in ihren Schriften, ist eines, das sie mit den Schriften des Evangeliums insbesondere verknüpft, mit dem Licht, das die griechische Ilias durchdringt, mit dem Licht, das altorientalische Schriften wie die Bhagavad Gita betrifft, und von dem sie – und hier wird es unangenehm für den zeitgenössischen Leser – von dem sie sagt, es sei letztlich nicht menschlichen Ursprungs, sondern ein transzendentes Licht, von dem man erfasst werden muss, für das man sich offenhalten muss, das man aber nicht selbst erzeugen kann, und das, wie Simone Weil überzeugt ist, im eminenten Sinne nicht von dieser Welt allein sein kann.
Gnade als Außerweltliches.
Wofür man sich weltlich offenhalten kann. Und das sich weltlich umsetzen lässt.
Am Ende ihres Textes steht ja ein Bruch. Dort schaut sie auf ihre eigene Arbeit, aber fragt sich auch, wie die Ilias überhaupt wirklich werden konnte. Wie konnte ein solcher Text geschrieben worden sein, wo kommt der her? Sie verbindet ihre Gewaltstudie sodann mit dem Evangelium; was einer der Gründe war, warum dieser Text erstmalig nur pseudonym, vorgeblich geschrieben von einem Émile Novis, veröffentlicht werden konnte. Simone Weil wusste um die Widerstände gegen eine Verknüpfung der modernen Gewalt mit dem Neuen Testament.
Das hing mit den jeweiligen Kreisen zusammen, in denen Simone Weil sich aufhielt, und in die sie Kontakte pflegte. Im breiten Kontext ist Simone Weil ja auch deshalb die große Vergessene, weil sie für sämtliche dominanten Rezeptionslinien der Nachkriegszeit extrem unbequem blieb. Sie ist eine Gewerkschaftsaktivistin, die die stalinistische Desillusion erlitt und sich zu einer der stärksten Kritikerinnen des totalitär gewordenen Sozialismus wandelte. Sie ist eine jüdisch Geborene, die zum Katholizismus hinneigte, ohne sich indes taufen zu lassen. Und schließlich eine Existenzialistin, die in Mystik und Askese drängt. So fällt sie durch alle Aneignungsraster.
Die Kontinuitätserzählung des »Lichts«, die sie im Text und vergleichbaren Texten dieser späten Phase entwickelt, ist letztlich eine Kontinuitätserzählung über das Wesen Europas. Das jüngste Buch, das ich geschrieben habe, heißt ja Feuer der Freiheit. Sie sieht von den Griechen ausgehend eine Art Lichtereignis, das sich in verschiedenen Konstellationen kontinuierlich weitergetragen hat. Im Sinne einer Fackelübergabe. Sie sieht das von Homer bis hin zu den Evangelien. Sie sieht allerdings auch Spuren einer Auslöschung dieses Lichts, durch die Kräfte des römischen und des »hebräischen« Denkens, wie sie sagt. Auch hier sehen wir eine große Unbequemheit ihres Denkens. Am Ende von Ilias oder Das Poem der Gewalt stellt sie die Römer und die Hebräer als kulturelle Kräfte heraus, die in ihrer Selbstbeschreibung die Blindheit gegenüber dem Wesen der Gewalt vorantrieben, die sich in der Selbstermächtigung jeweils einfanden und wohlfühlten. Von den Römern sagt sie, sie hätten es als selbstverständlich und natürlich angesehen, die Unterlegenen zu knechten; und von den Hebräern, dass diese immer ihren Gott als Stammesgott begriffen hätten, der sie dazu berechtigt, das Leid, das andere ertragen, als gerechtes Leid zu adressieren. Sicher eine sehr eindimensionale und bestreitbare Lesart der jüdischen Tradition. Der griechische und der christliche Impuls ist für sie jedenfalls derjenige, den es wachzuhalten und zu pflegen gilt.
Das Feuer weist auf Prometheus, der es ja den Göttern stahl, um es den Menschen zu bringen. Ein Gedanke, der sich verschleiert auch in der Aufklärung wiederfindet. Wenn Kant in »Was ist Revolution?« – dem Schwestertext zu »Was ist Aufklärung?« – die Umbrüche seiner Zeit reflektiert, dann geht es dort, anders als oft angenommen wird, nicht um die Geste des Revolutionärs, der vor allen anderen auf die Straße geht und so die Revolution anführt. Es geht um die Begeisterung an der Revolution, das prometheusche Feuer. Simone Weil hingegen schreibt, die antiken Vorbilder hätten keine Nachahmer gefunden.
Ist dem, wo es doch die Aufklärung gegeben hat, wirklich so?
Das ist ganz interessant, wie du das sagst. Da ist eine Widersprüchlichkeit oder scheinbare Widersprüchlichkeit, die in Weils gesamtem Zugang gründet. Diese Licht- und Feuermetaphorik zieht sich bis in die Aufklärung hinein. Aber die spezifische Einschränkung, die Simone Weil an allem, was wir heute »modernes Denken« nennen, diagnostiziert, liegt in dessen Immanenz-Sucht, welche die Verortung der Quelle dieses Feuers vorherbestimmt: in der stillschweigenden Voraussetzung (die Descartes ganz sicher nicht teilte), dass der Ursprung dieses Feuers etwas rein Immanentes sein müsste, etwas, dass durch rein menschliche Erkenntnisprozesse, menschliches Wollen erzeugbar und verfügbar wäre. Simone Weil würde dies als falsche Bezeichnung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, kennzeichnen. Es ist eine falsche Modellierung dessen, was es heißt, zu erkennen und insbesondere: zu denken. Und eine falsche Modellierung dessen, worin die Werte, die unsere Existenz leiten, eigentlich verortet sind. Man kann dieses Licht nicht wollen, man muss von ihm erfasst werden. Aktivität wandelt sich zur Passivität. Man kann das Licht nicht herbeivernünfteln. Es wird in der Erfahrung vergegenwärtigt. Es verweist auf Quellen, die in der Transzendenz gründen. Wenn man so spricht, denkt man ja schon fast, man stünde auf der Kanzel einer imaginären Religion und spricht nicht mehr zu Zeitgenossen. Als sei man ein furchtbar reaktionärer Mensch. Jedoch ist die Art und Weise, wie Simone Weil die Geschichte des Abendlandes rekonstruiert, anders. Mit ihrem geradezu prophetischen Gestus verkörpert sie eine Immanenzverweigerung. Die Quellen von Normativität sind mit Weil nicht als rein immanente und nicht als rein rationale zu rekonstruieren oder zu verstehen. Das ist eine andere Lesart der Moderne; keineswegs die dominante. Immer auch steht sie ein wenig im Verdacht, etwas Reaktionäres zu wollen. Ich würde sagen, ohne es hier auszureizen, dass wir Simone Weil als eine Zeigehandlung betrachten sollten, die eine Art Linkstranszendenz freilegt. Ein Gedanke, den wir politisch sehr schwer denken. Ich würde meinen, Weil ist das erste Aufflackern einer Tradition der Linkstranszendenz, die vielleicht in Zukunft erst noch zu entwickeln wäre. Ich sehe zum Beispiel in den Schriften und Arbeiten Omri Boehms eine wichtigen neuen Strang in diese Richtung.
Simone Weil läuft damit neben jenen, von denen wir bisher glaubten, sie seien die Einzigen, die so etwas wie eine Kritik der Polizei oder eine Kritik der Gewalt betrieben. So ist Walter Benjamin immer noch für viele ein erster Ansprechpartner. Aber auch Simone Weil könnte die Stimmbildnerin einer linken Zeitkritik sein. Dabei schreibt sie auch von der Liebe, was schnell zu einer blumigen Wendung der Form »Liebe statt Gewalt« werden kann. Führt dieser gedachte Wahlspruch zu irgendetwas?
Zunächst würde ich mit Blick auf Benjamin anmerken, dass er oftmals als immanenter Gewaltkritiker gesehen wird, obwohl das transzendente Element bei ihm sehr stark ausgeprägt ist, wie ich auch versucht habe in der Zeit der Zauberer darzulegen. Das liegt einfach daran, dass er in der Aufnahme durch die Kritische Theorie seiner Transzendenzmomente vollständig beraubt wird – und damit auch banalisiert und platt politisiert wird.
Wenn du von der Liebe bei Simone Weil sprichst, dann hat das natürlich nichts mit »Make Love Not War« zu tun, nichts mit dem 68er-Wirrnis, wonach man durch körperliche Befreiung und erotisches Ausagieren eine neue Gesellschaft herbringen kann. Vielmehr ist es eine platonische Liebe, die unkörperlich zu denken ist und als ein Ereignis der Offenbarung und Gewahrwerdung, für das Menschen sich offenhalten können. Ich würde sagen: nichtmenschlichen Ursprungs und auch nicht primär zwischen Menschen vorhanden. Wenn man sich die zwei Achsen horizontal und vertikal vorstellt, wobei der Andere als anderes Angesicht horizontal und der Andere als göttliches Angesicht vertikal liegt, dann ist die Liebe, von der Weil spricht, die göttliche Liebe in der Vertikalität. Die Liebe, welche das Feuer, von der die Rede ist, nährt. Das ist, so glaube ich, auch die Aussage der platonischen Lehre. Insofern: Ja! Let love reign. Aber es ist eine andere Liebe als diejenige, an die wir uns in unserer Kultur derzeit gewöhnt zu haben scheinen.
Inwiefern?
Wenn man sich etwa die Black Lives Matter-Bewegung ansieht, da ist es doch gar nicht zu verstehen, wie ein Text wie dieser nicht eingebracht wird von denen, die darüber sprechen. Liegt das nur daran, weil man mit diesem Text sagen könnte, dass es sich bei den weißen Polizisten selbst um Opfer handelt? Die ebenfalls eine lange Geschichte der methodischen Entmenschlichung hinter sich haben? Und die wir falsch adressieren, wenn wir sie rein als Täter adressieren? Es sind Menschen, die in dieser Dynamik selbst Gefangene sind. Wenn man so was zum Beispiel tweeten würde, hätte man gehörige Probleme, obwohl es mit Weil ein heilender Gedanke wäre. Die derzeitige Kritik der Gewalt ist genau von der Blindheit betroffen, die Simone Weil anprangert. Deswegen führt diese Kritik auch zu keiner Lösung des Problems, sondern zu verstellender Verabsolutierung eigener Opferperspektiven.
Die Symmetrie der Gewalt wird also nicht gesehen. Währenddessen wünschen wir uns in Deutschland eine Soziologie der Gewalt innerhalb polizeilicher Strukturen. Wäre das ein Anwendungsfall für Simone Weil?
Das wäre einer. Wenn er sich nicht in dem fingerzeigenden Gestus erstickt, wonach die Polizei an sich böse wäre, dass es verdrängte Probleme gäbe, und dass wir schon wüssten, wer schuld ist. Was mich dagegen aufbringt, sind Lesarten wie die von Daniel Loick, die eine Gewalterfahrung namhaft machen und so tun, als ob sie schon wüssten, wo der Schuldige zu suchen wäre. Das ist eine sehr banale, strukturell genährte Lesart dessen, dass man mit immer blinder Einseitigkeit markiert, wo allein das Problem liegt. Und dann natürlich auch totale Patentrezepte zur Lösung im Rucksack hat. Bei Simone Weil ist es so, dass sie einen vor einer Banalisierung des Ausgangs von Vorneherein – bewahrt. Und dass sie übrigens auch nicht davon ausgeht, dass man Gewalt aus der Welt schaffen kann. Sie geht auch nicht davon aus, irgendjemand sei daran schuld, dass es Herrschafts- und Symmetrieverhältnisse der Unterwerfung und der Machtausübung gibt. Sie geht eher davon aus, dass jeder Versuch, Asymmetrien in menschlichen Verhältnissen auszumerzen, noch viel gewaltsamer sein müsste als die Gewalt, die vorherrscht. All das sind Motive, die für Menschen, die weitgehend aus der Kritischen Theorie kommen und jetzt politisch aktiv werden im Sinne des Abolitionismus, eher unbequem sind. Unbequem bleiben. Weil sie das, was dort als Utopie, als Fluchtlinie propagiert wird, von Vorneherein als eine Form von revolutionär motiviertem Unsinn markieren – eine Position die im Namen der politischen Mobilisierung verkennt, was es heißt, ein Mensch unter anderen Menschen zu sein.
Und wieder zeigt sich die Blindheit, von der wir gesprochen hatten:
»Wenn es allen von Geburt an beschieden ist, Gewalt zu erleiden, so ist dies eine Wahrheit, vor der die Macht der Umstände den Menschen die Augen verschließt. Der Starke ist nie ganz und gar stark, der Schwache nie ganz und gar schwach. Aber beide wissen es nicht. Sie glauben nicht, von der gleichen Art zu sein. Weder fühlt sich der Schwache dem Starken gleich, noch wird er als solcher betrachtet.«
Ja. Was mit diesen Zeilen immer verbunden ist, betrifft die Gefahr der moralischen Überhebung von Individuen, die meinen, aus diesem Gerüst ausgebrochen zu sein, und dann aktiv werden zu können. Das ist die Form von Eitelkeit, die, wie ich glaube, Simone Weil als eigentlich böse markieren will. Dann ist es egal, ob man es mit einer Rhetorik der Menschlichkeit, des revolutionären Gerechtigkeitsstrebens tut oder nicht – dann hat man schon den Blick zu sich selber so weit verstellt, dass alles, was man tut, eher unheilvoll als heilsam sein kann. Dafür steht Simone Weil innerhalb der linken Bewegung. Für die selbst erzeugten und selbst perpetuierten Blindheiten eines linken Milieus, das meint, die Gerechtigkeit bei sich auf seiner eigenen Seite zu wissen. Das ist auch etwas, das Hannah Arendt ständig aufbringt. Ich will das nicht als reaktionär nehmen, sondern vielleicht eher die Linkstranszendenz als mögliche Alternative stark machen, weil sie Momente in die Diskussion einbringen kann, von denen alles, was derzeit linker Diskurs ist, belastet bleibt. Und offenbar auch gewisse Lehren aus der Vergangenheit noch nicht gezogen hat.
Die Schönheit der Texte liegt in den Spuren, die sie sind. Wo geht es weiter, wenn dieser Text erst einmal gelesen wurde?
Du fragst nach der Aufnahme eines Lektürewegs?
Ja.
Nun, Simone Weil hat vor allem literarische Aufnahmen erfahren. Bei Camus. Er ist der große Erbe ihres Denkens. Und ich glaube, dass man Emmanuel Carrère, den ich für den derzeit bedeutendsten Schriftsteller halte, mit Simone Weil sehr gut rekonstruieren kann. Das Reich Gottes ist ein Buch, das von Weil’schen Motiven durchdrungen ist. Aber auch wenn du David Foster Wallace liest, This is all water. Es ist, als sei dieser Text mit Weils Texten zusammen auf einem Tisch geschrieben worden. Innerhalb einer Tradition von Literaten, die sich für die Transzendenz offenhalten, ist Simone Weil präsent.
Wolfram Eilenberger ist ein deutscher Philosoph. Länger schon als seine Bücher es andeuten, arbeitet er an einer alternativen Geschichte der Philosophie, einer Philosophie als {Lebensform: »Man kann sich leicht eine Frage vorstellen, die nur aus Befehlen und Meldungen in der Schlacht besteht. – Oder eine Sprache, die nur aus Fragen besteht und einem Ausdruck der Bejahung und der Verneinung. Und unzählige Andere. – Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen.« Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 19}. Sein jüngstes Buch Feuer der Freiheit (2020) greift die Leben von Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand zusammen. Für Die Zeit der Zauberer (2018), das ähnlich polyphon von Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger erzählt, erhielt er den Prix du Meilleur Livre Étranger. Wolfram Eilenberger war langjähriger Chefredakteur des Philosophie Magazins, schrieb als Kolumnist für Die Zeit, ist Mitglied der Programmleitung der »phil.cologne« und moderiert in loser Regelmäßigkeit die »Sternstunden der Philosophie« im Schweizer Fernsehen.
Text: Simone Weil, »Die Ilias oder das Poem der Gewalt«, erschienen in Krieg und Gewalt. Essays und Aufzeichnungen (Zürich: diaphanes 2011)
Produktion: Holm-Uwe Burgemann, Simon Böhm, Konstantin Schönfelder
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.